




In unserer Zeitschrift Gestaltkritik haben wir bereits mehrere Beiträge von und über Barry Stevens veröffentlicht:
Der Inhalt des neuen Buches
Anke und Erhard Doubrawa: Geleitwort zur neuen deutschen Ausgabe
007 (Leseprobe 1)
Carl R. Rogers: Vorwort 011 (Leseprobe 2)
Barry Stevens: Einführung 013
Barry Stevens: Vorspiel 019 (Leseprobe 3)
I. Barry Stevens: Aus meinem Leben 023 (Leseprobe
4)
II. Barry Stevens 035
Carl R. Rogers: Der Prozeß des Wertens beim reifen Menschen
039
III. Barry Stevens 055
IV. Barry Stevens 073
Carl R. Rogers: Lernen frei zu sein 077
Carl R. Rogers: Die zwischenmenschliche Beziehung als Zentrum von
Beratung und Therapie 097
V. Barry Stevens 113
VI. Barry Stevens 121
Eugene T. Gendlin: Subverbale Kommunikation und therapeutische
Ausdrucksfähigkeit: Tendenzen in der klient-zentrierten Therapie
mit Schizophrenen 12
VII. Barry Stevens 145
VIII. Barry Stevens 141
John M. Shlien: Klient-zentrierte Therapie bei Schizophrenie: Erste
Annäherung, 155
IX. Barry Stevens 169
X. Barry Stevens 171
Carl R. Rogers: Einige Untersuchungsergebnisse aus der Psychotherapie
mit Schizophrenen 185
XI. Barry Stevens 197
XII. Barry Stevens 203
Wilson van Dusen: Die natürliche Tiefe im Menschen 215
XIII. Barry Stevens 241
XIV. Barry Stevens 267
Weiterführende Literatur 277
Die Autoren 279

Und schließlich die Leseproben
Anke und Erhard Doubrawa: Geleitwort zur neuen deutschen Ausgabe
»Barry Stevens ist in erfrischender Weise nicht-autoritär und herrschaftskritisch. Sie trägt in ihrer persönlichen Art die rebellische, gesellschaftskritische Grundhaltung der Gestalttherapie weiter, wachsam und höchst sensibel gegenüber jeder Form von Herrschaftsausübung, Überwältigung und Entfremdung des Individuums.«
Detlev Kranz, in: Gestaltkritik 1/1999
Dieses Buch stammt aus dem Jahre 1967. Fasziniert spüren wir beim Lesen die unbekümmerte Frische, die Aufbruchstimmung und die Hoffnung jener Zeit. Der Aufruf der Autoren - des Gesprächstherapeuten Carl Rogers und der späteren Gestalttherapeutin Barry Stevens - zu einem freien, selbstbestimmten und glücklichen Leben hat an Aktualität bis heute nichts verloren.
Schon die unvergleichliche Gestalt des Buches ist ein wirklich beachtliches Projekt. Barry Stevens sammelte einige grundlegende Artikel zur Gesprächstherapie von Carl R. Rogers, Eugene T. Gendline, John M. Schlien und Wilson van Dusen. Dazu beschieb sie ihren inneren Prozeß beim Lesen dieser Beiträge: ihre Reaktionen, Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen… So verbinden sich auf eine einzigartige Weise Wissenschaft und Lebenspraxis. Das Buch ist darum eine bereichernde Lektüre für alle, die auf der Suche nach ihrem persönlichen Weg sind - oder sich auf diese Suche begeben möchten.
Barry Stevens (1902-1982) war eine bemerkenswerte Frau, die ein recht unkonventionelles Leben führte. Fritz Perls nannte sie ein »Natur-Talent« unter den Psychotherapeuten, als sie 67-jährig (!) ihre Gestalttherapie-Ausbildung bei ihm begann.
Barry Stevens hat sich intensiv mit der Lebensaufgabe auseinandergesetzt, wie man zu dem zurückfindet, was einen selbst eigentlich ausmacht - indem man lernt, den eigenen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Wertsetzungen wieder Vertrauen zu schenken (»Selbst«-Steuerung versus »Fern/Fremd«-Steuerung).
Unter Mühsal und Schmerzen ist sie zu dieser Einsicht gekommen. Denn ausgelöst wurde ihre innere »Fährtensuche« durch eine schwere chronische Krankheit und durch einschneidende persönliche Krisen. Bei ihren Reflexionen geht es ihr um Schulung und Entwicklung dessen, was sie ihren »inneren Fährtensucher« nannte: die Entwicklung von awareness (Gewahrsein, Achtsamkeit, Aufmersamkeit, Bewußtheit).
Natürlich holte sich der »innere Fährtensucher« auch Anregungen von außen: Barry Stevens hielt Kontakte zu Gelehrten ihrer Zeit wie dem Schriftsteller Aldous Huxley, dem Philosophen Betrand Russel, dem Psychotherapeuten Carl R. Rogers. In den 1930er und 1940er Jahren hatte sie mit den Ureinwohnern Hawaiis zusammen gelebt und gearbeitet, in den 1950er und 1960er Jahren mit den Nawajo- und Hopiindianern. Außerdem beschäftigte sie sich intensiv mit östlichen spirituellen Traditionen: Buddhismus, Tai Chi u.a.
Mit Fritz Perls und der Gestalttherapie kam sie erst 1967 in Berührung - in dem Jahr, in dem sie das hier vorliegende Buch gemeinsam mit Carl Rogers veröffentlichte. Es erschien übrigens als erstes Buch im eben von ihrem Sohn John O. Stevens gegründeten Verlag »Real People Press«. Hier sollten - mit Barry Stevens tatkräftiger Mitwirkung - später noch andere wichtige Bücher zur Gestalttherapie erscheinen.
In der Entwicklung der Gestalttherapie hat Barry Stevens eine bedeutende Rolle gespielt. Leider ist sie im deutschsprachigen bisher weitgehend eine Unbekannte geblieben. In den 1980er Jahren hatte Hilarion Petzold Barry Stevens' Artikel über »Gestalt-Körperarbeit« in einem von ihm herausgegebenen Sammelband veröffentlicht (»Die neuen Körpertherapien«, Junfermann Verlag, 1985). Etwa gleichzeitig war im Junfermann-Verlag das hier vorliegende Buch von Barry Stevens und Carl R. Rogers zum ersten Mal in deutscher Sprache erschienen.
Noch ein weiteres Dutzend Jahre ging ins Land. Dann hat der Hamburger Gestalttherapeut Detlev Kranz für unsere Gestalttherapie-Zeitschrift »Gestaltkritik« einen Artikel über Barry Stevens geschrieben. Dieser machte uns neugierig auf diese Frau.
Inzwischen haben wir bereits einen weiteren Aufsatz von Barry Stevens in der »Gestaltkritik« gedruckt: »Das Leben findet nicht im Kopf statt. Gewahrsein als Grundlage der gestalttherapeutischen Haltung« (Gestaltkritik 1/2000).
Schließlich haben wir ihr in den USA einflußreiches Buch »Don't push the river. Gestalttherapie an ihren Wurzeln« (Edition des Gestalt-Instituts Köln/GIK Bildungswerkstatt im Peter Hammer Verlag, 2000) zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Detlev Kranz über dieses Buch:
»Ich kenne niemanden in der Gestalttherapie, der einsichtsvoller und schöner über Bewußtheit geschrieben hat, über eine Bewußtheit, die beständig eingewoben ist in das alltägliche Leben. Und die dadurch das alltägliche Leben heilsam sein läßt.«
Barry Stevens' Haltung ist für uns Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten auch heutzutage besonders wichtig: Gestalttherapie ist nicht einfach eine Ansammlung von psychotherapeutischen Methoden, die nur noch irgendwie angewandt werden müßten. Vielmehr macht die Haltung die Gestalttherapeutin oder den Gestalttherapeuten aus: Achtungsvoll unterstützt sie/er das Subjekt-Werden/-Sein ihrer/seiner Klientin oder ihres/seines Klienten. »Lernen, frei zu sein« - dieser Slogan von Carl Rogers, zu dem im vorliegenden Buch ein bemerkenswerter Aufsatz abgedruckt ist (S. 77ff), faßt es sehr schön zusammen. Wir empfehlen den Aufsatz jedem, der, wie wir, Unbehagen über die wohlfeile Häme verspürt, mit der gegenwärtig die Ziele der »antiautoritären Erziehung« und »antiautoritären Bewegung« der 1960er Jahre überzogen wird.
Zum kritiklosen Übernehmen irgendwelcher Methoden gibt es einen treffenden Satz von Barrys Sohn John O. Stevens, der auch die Meinung seiner Mutter gut wiedergibt: »Viele Gestalttherapeuten sind eine Art ›runderneuerte‹ Therapeuten, die ein paar Gestalttricks aufgegriffen haben, so daß sie auf den fahrenden Zug aufspringen können.« (»gestalt is«, Real People Press, 1975).
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Köln, im Februar 2001
Anke und Erhard Doubrawa, Gestalttherapeuten

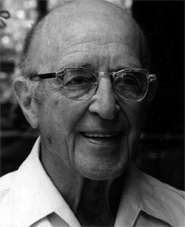
Leseprobe 2
Carl R. Rogers: Vorwort
Dies ist ein ungewöhnliches Buch, von einer einzigartigen Persönlichkeit zusammengestellt, die dabei einige Aufsätze zum Ausgangspunkt genommen hat, welche einen außergewöhnlichen Standpunkt darstellen. Lassen Sie mich das erklären.
Zunächst einmal steht jeder Aufsatz (einige davon sind von mir selbst, andere von Drs. Gendlin, Shlien und van Dusen) in einem Kontext, der eine warmherzige und menschliche Reaktion auf die Aufsätze darstellt. Barry Stevens betrachtet jeden dieser Aufsätze als eine Art Oase in der heutigen Fachliteratur und hat auf liebenswerte Art und Weise jeden von ihnen in eine Umgebung gerückt, in der sie ihre eigenen persönlichen Gedanken und Assoziationen zu dem Thema des Autors beiträgt. Ihre Kommentare sind keine Kommentare zum Aufsatz, ebensowenig eine Kritik. Sie beschreiben die sehr persönlichen Gefühle und Gedanken, die der Aufsatz in ihr ausgelöst hat. Es ist, wie wenn ein Freund Ihnen seine durch eine Lektüre hervorgerufenen vielfältigen Gedanken und Gefühle erzählt. So werden Sie angeregt, den jeweiligen Text selbst zu lesen, um herauszufinden, was er Ihnen gibt. Dies scheint ein sehr natürliches, aber sicherlich kein konventionelles Verfahren zu sein. Nach einem solchen Verfahren werden Bücher gewöhnlich nicht geschrieben oder konzipiert.
Im Zusammenhang mit Barry Stevens überrascht dieser Umstand nicht. Barry Stevens ist ein Mensch, der nicht leicht einzuordnen ist. Obwohl sie viele der Großen und der Beinahe-Großen der westlichen Kultur kennt oder mit ihnen in Korrespondenz steht, hat sie selbst keine Position, keinen Status inne, keine berufliche Klassifikation; man könnte sie höchstens vage als »Schriftstellerin« bezeichnen. (Ich glaube, sie würde den Ausdruck »Amateur« bevorzugen, weil sie tief davon überzeugt ist, daß der »Amateur« und der »Profi« sich gegenseitig ergänzen.)
Barry Stevens ist unabhängig in ihrem Denken und in ihrem Leben, und sie versucht fortwährend, aus den Grenzen auszubrechen, die uns alle festhalten und einengen. Einen großen Teil dieses Buches schrieb sie als Gast des Western Behavioral Sciences Institute, und sie wurde während dieser Zeit mit ihrer ruhigen, entspannten Art eine wichtige Person in dem Leben vieler Menschen, die dort arbeiten. Auf irgendeine Weise hat sie in ihrem Leben einen Stand von Weisheit erreicht, der heutzutage allzu selten zu sein scheint, da stattdessen das Wissen so überaus wichtig geworden ist. Viele Leser mögen ihre persönlichen Anmerkungen zu den Texten wertvoller und befriedigender finden als die Texte selbst.
Barry Stevens sieht oft das Wesentliche der Dinge mit einer besonderen Wahrnehmungsgabe. Ich denke aber, daß die Einzigartigkeit ihrer Person in ihren Kommentaren zum Ausdruck kommt, deshalb möchte ich es dem Leser überlassen, sie für sich selbst zu entdecken. Die in diesem Buch enthaltenen sieben Aufsätze gehen von einer in der heutigen Psychologie ungewöhnlichen Voraussetzung aus, nämlich, daß der subjektive Mensch eine Bedeutung und einen sehr grundlegenden Wert hat: Ungeachtet in welche Rolle er gedrängt oder wie er bewertet wird, ist er zunächst einmal und vor allen Dingen eine menschliche Person und das im tiefsten Sinne des Wortes. Er ist nicht nur eine Maschine, nicht nur eine Ansammlung von Reiz-Reaktions-Mustern, kein Objekt, keine Schachfigur. Die Aufsätze behandeln eine Vielzahl von Themen (und bei mindestens drei Beispielen geht es um Menschen, die als »abnorm« etikettiert werden), aber im tiefsten Sinne geht es immer um Personen.
Aus diesem Grund finden sie möglicherweise Anklang bei anderen Menschen - Menschen, die, wie die Autoren, sich darum bemühen, wie man am besten seinen eigenen Weg im Leben finden kann und wie man es besonders lohnend leben kann. Offensichtlich hatten diese Aufsätze Wirkung auf einen Menschen: Barry Stevens; und ihre Reaktionen - manchmal charmant, manchmal bewegend, manchmal kritisch, manchmal tiefgründig - bilden die Verbindungsglieder zwischen der jeweiligen Thematik der Autoren.
Dieses Buch wäre nicht geschrieben, zusammengestellt oder veröffentlicht worden, wenn nicht alle Beteiligten geglaubt hätten, daß es eine Bedeutung für heutige Menschen habe. Möglicherweise entsteht in dem Leser ein Gefühl, das aussagt: »Dieses Buch hilft mir, mich selbst ein wenig besser zu verstehen, deswegen verstehe ich jetzt den anderen ein wenig besser, und deswegen bin ich etwas weniger verwirrt über uns beide.« Oder, um es etwas anders zu sagen, wir hoffen, daß der Leser durch dieses Buch ermutigt wird, das zu sein und zu werden, was er selbst ist.


Barry Stevens: Vorspiel
Am Anfang war ich eine Person, die nichts kannte als ihre eigene Erfahrung.
Dann erzählte man mir etwas, und ich wurde zwei Personen: das kleine Mädchen, das sagte, wie schrecklich es sei, daß die Jungen auf dem Grundstück nebenan ein Feuer machten, an dem sie Äpfel brieten (das war das, was die Frauen sagten) - und das kleine Mädchen, das hinauslief, wenn die Jungen von ihren Müttern gerufen wurden, um einkaufen zu gehen, und das Feuer und die Äpfel hütete, weil es das gerne tat.
Da gab es also zwei Ich's.
Das eine Ich tat immer etwas, das das andere Ich mißbilligte. Oder das andere Ich sagte etwas, das ich mißbilligte. So viel Streit in mir!
Am Anfang war Ich, und Ich war gut.
Dann trat das andere Ich auf den Plan. Die Autorität von außen. Dies war verwirrend. Und dann wurde das andere Ich sehr verwirrt, weil es so viele verschiedene äußere Autoritäten gab.
Sitz ordentlich! Geh aus dem Zimmer, um dir die Nase zu putzen! Tu das nicht, das ist albern! Nein, das arme Kind weiß nicht einmal, wie man einen Knochen abknabbert! Zieh nachts auf der Toilette ab, denn wenn du es nicht tust, ist es schwerer, sie zu reinigen! Zieh nachts nicht ab - du weckst die anderen auf! Sei immer nett zu den Leuten; selbst, wenn du sie nicht magst, darfst du ihre Gefühle nicht verletzten! Sei offen und ehrlich; wenn du den Leuten nicht sagst, was du über sie denkst, ist das feige! Buttermesser: Es ist wichtig, Buttermesser zu benützen. Buttermesser? Was für ein Unfug! Sprich ordentlich! Blöde Ziege! Kipling ist wunderbar! Ah! Kipling (dreht sich weg).
Das Wichtigste ist es, Karriere zu machen. Das Wichtigste ist, zu heiraten. Zum Teufel mit den anderen. Sei nett zu den anderen. Das Wichtigste ist Sex. Das Wichtigste ist, Geld auf dem Konto zu haben. Das Wichtigste ist, daß dich jeder mag. Das Wichtigste ist, sich gut anzuziehen. Das Wichtigste ist, weltmännisch zu sein und zu sagen, was du nicht meinst, und niemanden wissen zu lassen, was du fühlst. Das Wichtigste ist, jedem voraus zu sein. Das Wichtigste ist, einen schwarzen Seehundmantel und Geschirr und Silber zu haben. Das Wichtigste ist, sauber zu sein. Das Wichtigste ist, immer seine Schulden zu bezahlen. Das Wichtigste ist, von niemand anderem hereingelegt zu werden. Das Wichtigste ist, seine Eltern zu lieben. Das Wichtigste ist, zu arbeiten. Das Wichtigste ist, unabhängig zu sein. Das Wichtigste ist, korrektes Deutsch zu sprechen. Das Wichtigste ist, seinem Ehemann gegenüber pflichtbewußt zu sein. Das Wichtigste ist, darauf zu achten, daß deine Kinder sich gut benehmen. Das Wichtigste ist, sich die richtigen Theaterstücke anzusehen und die richtigen Bücher zu lesen. Das Wichtigste ist, das zu tun, was andere sagen. Und andere sagen all diese Sachen.
Die ganze Zeit über sagte Ich: lebe das Leben; das ist es, was wichtig ist.
Aber wenn Ich das Leben lebt, sagt das andere Ich: nein, das ist schlecht. All die verschiedenen anderen Ichs sagen das. Es ist gefährlich. Es ist nicht praktisch. Du wirst ein schlimmes Ende nehmen. Natürlich … jeder hat sich schon mal so gefühlt wie du, aber du wirst es noch lernen!
Aus all den anderen Ichs werden einige für das Muster gewählt, das mich ausmacht. Aber es gibt all die anderen Rastermöglichkeiten in dem, was all die anderen sagen, die in mich hinein kommen und das andere Ich werden, das nicht ich selbst ist, und manchmal werden diese bestimmend. Wer bin ich dann? Ich kümmert sich nicht darum, wer ich bin. Ich ist, und es ist glücklich, zu sein. Aber wenn Ich glücklich ist, sagt das andere Ich: fang an zu arbeiten, mach etwas, mach etwas, das sich lohnt. Ich ist glücklich, Geschirr abzuspülen. »Du bist komisch!« Ich ist glücklich, wenn es mit Leuten zusammen ist und nichts sagt. Das andere Ich sagt: Rede, rede, rede. Ich verliert sich.
Ich weiß, daß man mit Dingen spielen und sie nicht besitzen sollte. Ich liebt es, Dinge mühelos zusammenzufügen, Dinge mühelos auseinanderzunehmen. »Du wirst nie etwas haben!« Dinge aus Dingen machen, so, daß die Dinge selbst daran beteiligt sind, sie zusammenfügen, voll Überraschung und Freude für Ich. »Damit kann man kein Geld verdienen!«
Ich ist menschlich. Wenn jemand bedürftig ist, gibt Ich. »Das kannst du nicht machen! Du wirst nie etwas für dich selbst haben! Wir werden dich unterstützen müssen!«
Ich liebt. Ich liebt auf eine Art, die das andere Ich nicht kennt. Ich liebt. »Das ist zu eng für Freunde!« - »Das ist zu kühl für Liebende!« - »Mach dir nicht so viele Gedanken, er ist nur ein Freund. Es ist ja nicht so, als ob du ihn liebtest.« - »Wie kannst du ihn gehen lassen? Ich dachte, du liebtest ihn?« Kühl' also die Wärme für Freunde ab und erhitze die Liebe für Geliebte, und Ich geht verloren.
Beide Ichs haben also ein Haus und einen Mann und Kinder und all das, und Freunde und Ansehen und all das, und Sicherheit und all das, aber beide Ichs sind verwirrt, weil das andere Ich sagt: »Siehst du? Du hast Glück«, während Ich weiter weint. »Worüber weinst du? Warum bist du so undankbar?« Ich kennt keine Dankbarkeit oder Undankbarkeit und kann nicht streiten, Ich weint weiter. Das andere Ich stößt es hinaus, sagt: »Ich bin glücklich! Ich habe sehr viel Glück, solch eine nette Familie zu haben, und ein hübsches Haus und gute Nachbarn und eine Menge Freunde, die möchten, daß ich dies oder das tue.« Ich ist auch nicht zur Vernunft zu bringen. Ich weint weiter.
Das andere Ich wird müde und lächelt immer noch, weil man genau das tun soll. Lächle, und man wird dich belohnen. Wie der Seehund, dem ein Stück Fisch zugeworfen wird. Sei nett zu jedermann, und man wird dich belohnen. Die Leute werden nett zu dir sein, und damit kannst du glücklich sein. Du weißt, daß sie dich mögen. Wie ein Hund, dem man den Kopf tätschelt wegen seines guten Betragens. Erzähl' witzige Geschichten. Sei lustig. Lächle, lächle, lächle … Ich weint… »Bemitleide dich nicht selbst! Geh' raus und tu' was für die Leute!« - »Geh' raus, unter die Leute!« Ich weint immer noch. Aber inzwischen hört und fühlt man es nicht mehr so deutlich.
Plötzlich: »Was tue ich?« »Soll ich durchs Leben gehen und den Clown spielen?« - »Was mache ich, ich gehe auf Parties, die mir nicht gefallen?« - »Was mache ich eigentlich, ich bin mit Leuten zusammen, die mich langweilen?« - »Warum bin ich so hohl und leer?« Eine Muschel. Wie ist diese Muschel um mich herum gewachsen? Warum bin ich stolz auf meine Kinder und unglücklich über ihr Leben, das nicht gut genug ist? Warum bin ich enttäuscht? Warum fühle ich so viel Vergeudung?
Ich bricht durch, ein wenig. Für Augenblicke. Und wird vom anderen Ich zurückgestoßen.
Ich weigert sich, weiterhin den Clown zu spielen. Welches Ich ist das? »Sie war früher lustig, aber jetzt denkt sie zuviel über sich nach.« Ich läßt zu, daß Freunde wegbleiben. Welches Ich ist das? »Sie ist zuviel allein. Das ist schlecht. Sie verliert den Verstand.« Welchen Verstand?


Leseprobe 4
Barry Stevens: Aus meinem Leben I
»Es [das Kind] würde über die Sorgen lachen, die wir uns über Werte machen, wenn es sie verstehen könnte. Wie kann es jemanden geben, der nicht weiß, was er mag und was nicht, der nicht weiß, was gut für ihn ist und was nicht?«
Wenn ich das lese, fällt mir ein, was meine Freunde so oft zu mir sagten, als ich jung war: »Du hast Glück. Du weißt immer, was du willst.«Ich dachte, ein Mensch, der das nicht weiß, sei verrückt.
Im Alter von vierzig Jahren war ich erschreckt und verwirrt, weil ich offenbar nicht mehr in der Lage war zu wissen, was ich wollte. Nach meinen Begriffen war ich verrückt geworden.
Während ich nach einem Ausweg suchte, beschritt ich zwei Wege gleichzeitig: Ich forschte in meinem Inneren nach Fehlentwicklungen und ich suchte außerhalb meiner selbst etwas, dem ich Glauben schenken könnte und das mich wieder ins seelische Gleichgewicht bringen würde. Die Suche außerhalb meiner selbst war vergeblich. Ich habe noch nie etwas gefunden, mit dem ich in jeder Hinsicht übereinstimmen konnte. Die Suche nach Innen lohnte sich, und dabei fand ich heraus, daß ich es nicht nötig hatte, überhaupt an irgendetwas zu glauben. Alles, was ich brauchte, war in mir. Das Äußere war nur nützlich, wenn es mir dazu verhelfen konnte, mit dem in Berührung zu kommen, was in mir war. Aber als ich dann tatsächlich mit meinen inneren Wertsetzungen wieder in Kontakt kam, war es furchtbar schwer, ihnen zu vertrauen, weil sie in wesentlichen Dingen gegen das sprachen, was alle anderen sagten. Doch je mehr ich sie benutze, umso mehr vertraue ich ihnen; und wenn ich mich anderen Menschen wirklich nahe fühle, merke ich, daß ihre eingebauten Fährtensucher (mein Begriff für das, was Carl Rogers: »organismische Werte« nennt) mit meinen übereinstimmen. Der Unterschied zwischen der äußeren und der inneren Sicht ist folgender:
Als mein Sohn auf dem College war, wurde er dabei erwischt, daß er einen Roadster fuhr, der bis zum Bersten voll mit Leuten war, die teilweise noch auf dem Trittbrett standen. Die Strafe betrug 27 Dollar. Das war ein harter Schlag. Mein Sohn hatte seit seinem neunten Lebensjahr ziemlich viel gearbeitet. Vom College erhielt er ein Stipendium für das Schulgeld, verdiente sich aber ansonsten durch etliche Jobs noch Geld dazu und unterstützte auch mich, als ich mehrere Jahre lang krank im Bett lag. Für ihn bedeuteten 27 Dollar mehr als drei Tage Arbeit. Die Strafe zu bezahlen, war hart, aber er nahm es nicht übel. Er kannte das Gesetz und wußte, daß er dagegen verstoßen hatte. Er akzeptierte seine Verantwortung für das, was geschehen war.
Aber auf der Polizeiwache erzählte man ihm, daß er verantwortungslos gewesen sei. Dies traf ihn wirklich tief. Man veranlaßte ihn, sich »böse« zu fühlen, und das ist nicht gut. Noch dazu fühlte er, daß man ihm Unrecht tat und ihn falsch beurteilte, und das machte ihn sehr wütend. Gleichzeitig war er durcheinander gebracht, was wahrscheinlich schlimmer ist, als alles andere.
Einige Jahre später, als er an einer Universität in einem anderen Staat war, kamen zwei Polizisten an unsere Tür und baten um eine Spende für das Feuerwerk zur Feier des Vierten Juli. Wir fanden Feuerwerk ganz toll, und mein Sohn gab ihnen großzügig fünf Dollar, obwohl wir damals auch nicht viel Geld hatten. Nachdem sie fort waren, sagte er: »Bullen hasse ich immer noch. Ich fühle es, wenn ich sie sehe.«
Meiner Ansicht nach war er nicht verantwortungslos. Er hatte die anderen Jungen nur zwei Blocks vom Wohnheim zum Sportplatz gefahren, in einem Gebiet, wo es wenig Verkehr gab und nur langsam gefahren wurde. Ihm war bewußt, daß die jungen Männer auf dem Trittbrett standen, und er kannte ihre Achtsamkeit und ihre Fähigkeit, auf sich selbst aufzupassen. Er hatte selbst die Verantwortung übernommen. Für mich ist es kein Zeichen von Verantwortung, mit einer erlaubten Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometern in der Stunde zu fahren, wenn Teilstrecken der Straße für diese Geschwindigkeit zu unsicher geworden sind oder Wetterbedingungen das Fahren in diesem Tempo riskant werden lassen. Wer das tut, verhält sich ausschließlich nach den Buchstaben des Gesetzes, statt sein eigenes Wissen und seine eigene Wahrnehmung miteinzubeziehen, und wenn es zu einem Unfall kommt, fühlt er sich sicher, »nichts Falsches getan zu haben.« Die schlechte Straße war es oder das Wetter. Mir scheint, daß ich verantwortlich (responsible) bin, wenn ich auf alles um mich herum »antwort-fähig« (response-able) bin, und das Gegenteil davon sind Leute wie Eichmann, die »nichts Falsches getan haben«, weil sie das taten, was man ihnen befohlen hatte.
Fünf Tage nach einem vierwöchigen Krankenhausaufenthalt mußte ich einen Arzt aufsuchen, dessen Praxis in einer Privatklinik war. Im Wartezimmer merkte ich, daß ich vom Stuhl rutschte, und ich konnte mich nur auf dem Stuhl halten, indem ich mich an den Stuhllehnen festklammerte. Ich war nicht sicher, wie lange ich mich festhalten konnte, und merkte, daß mir schwindlig wurde. Ich schaffte es, aufzustehen und zum Empfang zu gelangen, wo ich mich über die brusthohe Theke lehnen und meine Finger an die gegenüberliegende Kante krallen mußte, um nicht auf den Boden zu rutschen. Ich sagte einer der Schwestern, daß ich mich hinlegen müßte. Sie fragte mich: »Wer ist Ihr Arzt? Haben Sie einen Termin? Wie ist Ihre Kliniknummer?« Was hatte das alles mit einem kranken Menschen zu tun, der sich dringend hinlegen mußte? Das war doch offensichtlich, ganz abgesehen davon, daß ich es ihr sagte. Sie war weder kalt noch bösartig und in vieler Hinsicht auch nicht dumm. Sie hatte aus sich einen »verantwortungsvollen« Menschen gemacht, der sich an Regeln hält, und ihre »Verantwortung« bezog sich auf ihren Job, so wie er durch die Verwaltung definiert war, und nicht auf die unmittelbare Not eines anderen menschlichen Wesens. Wie Eichmann.
Da in unserer Gesellschaft Erlebnisse dieser Art so häufig auftreten, bin ich davon überzeugt, daß jeder schon einmal in eine ähnliche Lage hineingeraten ist, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern sehr häufig. Dazu kommen noch die anderen Geschichten, von denen man hört, wie z.B. das Kind, das zur Polizeiwache gebracht wurde, weil es von einer Klapperschlange gebissen worden war. Anstatt es sofort ins nächste Krankenhaus zu bringen, ließen die Beamten das Kind auf der Wache sitzen und versuchten, seine Adresse zu ermitteln, um es in das zuständige Krankenhaus einliefern zu können. Jeder weiß von solchen Geschichten wie dieser, aber niemand tut etwas dagegen. Das kann einen wirklich in Panik versetzen.
Manchmal führen solche Erlebnisse nur zu Absurditäten. Im Süden Kaliforniens wollte meine Tochter während des Krieges an einem Zeichenkurs für Flugzeugtechnik teilnehmen. Der Leiter sagte, daß sie nicht teilnehmen könne, weil sie nach Abschluß des Kurses noch nicht achtzehn Jahre alt sein werde. So lauteten die Bestimmungen. Ich suchte ihn auf und fand, daß er ein prima Kerl war; er zuckte jedoch nicht mit der Wimper, als ich sagte: »Schauen Sie. Hier ist ein Mädchen, das sehr gut zeichnen kann und Flugzeuge liebt. Sie kommt aus einem Kampfgebiet und möchte etwas Nützliches tun. Sie ist genau das, was Sie brauchen, warum nehmen Sie sie nicht auf?« Er sagte, »Oh, das kann ich unmöglich machen! Da müßte ich über etliche Leichen gehen!« Ich dachte an die Leichen, die in Honolulu in Gräben geworfen worden waren, und an die Leichen, die in Pearl Harbor in Schiffen verfaulten, weil man keine Zeit hatte, sich um sie zu kümmern. Seine Bemerkung in diesem Zusammenhang war zu viel für mich. Ich sagte: »Was sind schon ein paar Leichen mehr im Krieg?« Das war für ihn zu viel. Er nahm sie auf.
Als mein Mann in den zwanziger Jahren Leiter der Kinderabteilung in einem Krankenhaus in New York war, gab es dort ein Kind, bei dem keiner der Ärzte herausfinden konnte, was ihm fehlte, obwohl alle darin übereinstimmten, daß es im Sterben lag. Mein Mann sprach privat mit einer Krankenschwester, die Babies liebte. Er verpflichtete sie zu Stillschweigen, bevor er ihr sagte, was er von ihr wollte. Das schreckliche Geheimnis war: »Kümmern Sie sich um dieses Baby, als ob es Ihr eigenes wäre. Lieben Sie es einfach.« Zu der Zeit war »Liebe« sogar für Psychologen Unsinn; für Ärzte und Krankenschwestern ist es immer noch ein Gefühl, das man für einen Patienten nicht empfinden darf. Das Baby erholte sich. Alle Ärzte stimmten darin überein. Aber wenn mein Mann den anderen Ärzten erzählt hätte, wie das geschehen konnte, wäre er kein Mediziner (vertrauenswürdig) mehr gewesen, sondern zu einem Mystiker (unzuverlässig) geworden. Selbst wenn einige seiner Kollegen ihm zugestimmt hätten, hätten sie nicht gewagt, für ihn zu sprechen, weil sie damit ihr gesellschaftliches Ansehen verloren hätten. Liebe war nicht »wissenschaftlich« weil man sie nicht messen konnte. Also lieber das Baby sterben lassen?
Zwei ziemlich berühmte Wissenschaftler erzählten mir unabhängig voneinander von ihren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen im Leben, und als sie gingen, sagten beide wörtlich: »Erzählen Sie niemandem, daß ich das gesagt habe!« Ein Psychologe sagte in der Schule etwas anderes als zu Hause. Auf diese Diskrepanz angesprochen, antwortete er: »Das war meine berufliche Meinung (in der Schule). Dies ist meine persönliche Meinung.« Wenn schizophren »geistige Spaltung« bedeutet, wer ist dann nicht schizophren? Kein Wunder, daß William Menninger auf die Frage, wie viele von uns an Gemütskrankheiten litten, antwortete: »Einer von einem von uns.«
Ich bin kein Arzt, Wissenschaftler oder Professor geworden, aber der Kampf zwischen selbstautorisiertem Handeln und dem Handeln nach fremden Autoritäten, wenn diese nicht mit mir übereinstimmen, geht weiter, selbst wenn ich sehr genau weiß, welche Autorität ich positiv bewerte. Es verletzt mich tief, wenn man mir sagt, daß ich verantwortungslos sei - es ist, als würde man mir ein Messer in die Brust stoßen und es noch einmal herumdrehen. Ich weiß also ungefähr, wie hart dieser Vorwurf Leute mit einem solchen Beruf treffen kann und warum sie nicht immer sagen, was sie denken. Wenn ich tue und sage, was alle sagen und tun, dann nennt mich niemand verantwortungslos. Aber genau dann bin ich verantwortungslos.
Ich bin widersprüchlich und inkonsequent (manche nennen mich einen Heuchler), wenn ich mich einerseits über Bestechung und Betrug in der Politik, der Regierung, Wirtschaft und Polizei beklage, andererseits auf Kosten meiner eigenen Integrität handle und rede, wofür ich mit Lächeln, Freundschaft, Anerkennung, einer guten Position, einem schönen Haus und all den anderen sogenannten erstrebenswerten und richtigen Zielen belohnt werde. Schlimm ist nicht, daß ich etwas angenommen habe, sondern schlimm ist, daß ich etwas aufgegeben habe, nämlich mich selbst, meine eigene Autorität, die auf meinem eigenen Wissen beruht. Diese Entwicklung beginnt selbst unter relativ guten Bedingungen so früh in unserem Leben, daß ich niemandem, mich eingeschlossen, Vorwürfe dafür machen könnte, daß er völlig durcheinandergerät; aber gleichgültig, wer mich in einen solchen Zustand gebracht hat: Ich bin die einzige Person, die mir da heraushelfen kann. Andere können sicherlich helfen - das haben sie auch getan -, indem sie zulassen, daß ich denke, was ich denke, mich entscheide, wie ich mich entscheide, und fühle, was ich fühle. Dennoch muß ich den Willen haben, dies alles in mir aufsteigen zu lassen und es zur Grundlage meines Handelns zu machen. Das kann bis zur Lächerlichkeit schwierig und erschreckend sein. Es mag vorkommen, daß einen irgendetwas beschäftigt, das von außen gesehen völlig bedeutungslos ist; aber das innere Geschehen sieht ganz anders aus.
Mein Mann - ein Kind seiner Zeit und Vertreter seines Berufsstandes - verachtete die »Mystik«. Das war derselbe Mann, der ein Baby heilte, indem er es in die Obhut einer liebevollen Krankenschwester gab. Seine Antipathien gegenüber »Swamis« und orangefarbenen Kleidern - mit denen ihn keinerlei direkte Erfahrung verband - waren so stark, daß er, als der von ihm bewunderte Aldous Huxley sich den Vedanta-Anhängern anschloß, voller Bitterkeit sagte: »Nur zu, kleiner Yogi.« Ich wurde von seinem Schauder angesteckt. Als ich mit den Kindern ein Jahr lang auf dem Festland war und mich auf die Suche nach meinen eigenen Wertvorstellungen machte, ging ich zu dem Vedanta-Tempel in Hollywood, um für mich selbst herauszufinden, was ich von Swamis und orangefarbenen Kleidern hielt. Ich habe das wirklich getan; die Art, wie ich davon berichte, ist jedoch irreführend. Mein Bericht enthält eine Klarheit, die zu jener Zeit noch nicht vorhanden war. Also würde ich genauer sagen: »Ich wußte nicht, was ich tat, aber ich wußte, daß ich es tun mußte« - das ist die Weisheit des Organismus, von der Carl Rogers spricht, die uns steuert.
Während der Zeremonie lief mir ein Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ich dachte, daß ich von Sinnen gewesen sein mußte, hierher zu kommen, weil mir niemand einfiel, der das nicht mißbilligen würde. Irgend etwas veranlaßte mich, zu bleiben, nicht wegzulaufen. Obwohl ich jahrelang zu den Leuten gehört hatte, die Händeschütteln ablehnen, ging ich anschließend zu dem Swami und schüttelte ihm die Hand. Ich wußte nicht, warum, aber ich mußte es einfach tun. Als ich ihn ansah, fühlte ich mich plötzlich etwas wackelig, und ich sagte mit zitternder Stimme, aber mit echtem und tiefem Gefühl: »Danke.« Ich kam mir wegen meiner Zittrigkeit und wegen meiner Gefühle dumm vor, aber mein Zustand machte keinen Eindruck auf den Swami: er blieb unverändert. Er akzeptierte mich gleichermaßen vorher, währenddessen und nachher. Eigentlich wußte ich gar nicht, wofür ich ihm gedankt hatte, bis ich erkannte, daß ich den Typ mochte. Er war echt. Seine Echtheit und Unverfälschtheit halfen mir zu durchbrechen, was mich blockiert hatte; und der Kampf, der in mir stattfand, fühlte sich wie eine Teufelsaustreibung an - wie ein Ausbruch aus einer Zwangsjacke. Aber irgendwie kam ich heraus.
Ich bin sicher, daß es falsche Swamis gibt, genauso wie es andere Heuchler gibt - Pfarrer, Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler -, aber dieser eine war es nicht. Niemals wieder könnte ich eine derartige Abneigung einer ganzen Gruppe - in diesem Fall den Swamis - gegenüber hegen. Meine gesamte Erfahrung mit diesem Swami beschränkte sich auf diese Begegnung von Angesicht zu Angesicht.
Ein anderes Mal aß ich mit einem Swami zu Mittag, der gerade aus Indien gekommen war, ein aufrichtiger, aber auch sehr nervöser junger Mann. Wieder ein anderer Swami veranlaßte mich bei seinem einstündigen Vortrag, ständig auf die Uhr zu schauen. Seitdem bin ich nicht mehr in der Lage, an »Swamis« als solche zu denken; ich kann nur noch jeden für sich betrachten, und das gefällt mir, weil es der Realität entspricht. Bis jetzt habe ich noch niemanden kennengelernt, der in eine Kategorie paßte oder die Rolle ganz ausfüllte, in die man ihn gedrängt hatte. Manche Leute waren schlimmer, manche besser, aber die Klassifizierung selbst war irreführend.
Ich jedenfalls war nun für »Mystik« offen. Ich akzeptierte sie nicht, blockte sie aber auch nicht ab. Ich hatte die Freiheit, sie zu erforschen oder auch nicht, aber ich wußte, daß ich nichts darüber sagen konnte, bis ich sie wirklich erforscht hatte - bis ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und wissen konnte, worüber ich redete. Dies scheint ein Teil des eingebauten »Fährtensuchers« zu sein, der seinen eigenen Weg findet, gleichgültig was irgendein anderer sagt oder denkt. Der Fährtensucher handelt aufgrund der Information, die er hat, jedoch versuchsweise, und er ist offen für Veränderungen, wenn weitere Informationen dazukommen. Meinem rationalen Denken scheint diese Vorgehensweise irrational, sie ist aber - in der Begrifflichkeit meines eigenen Lebens - wissenschaftlicher. Der Fährtensucher erforscht, entdeckt, prüft, ist jederzeit für erneute Auswertung und ständiges Lernen offen. Fehler irritieren oder verwirren ihn nicht. Er interessiert sich für das Geschehen, für Lernprozesse, für Bewegung. Er besitzt ebensowenig »wissenschaftliche Kälte«, wie die Nobelpreisträger Linus Pauling und Albert Szent-Gyorgyi »kalt« sind - sie sind warmherzig, menschlich, begeistert, nehmen sich selbst nicht allzu ernst und sind sehr lebendig.
Man braucht nur einen gesunden Säugling oder ein kleines Kind zu beobachten, das ständig prüft und erforscht und daran Freude hat, um zu wissen, was ich in mir wiederentdeckt habe.
Als ich klein war, verwirrte mich unter anderem Folgendes: Wenn ich etwas sah und ausprobieren wollte und das dann auch tat, sagten die Erwachsenen manchmal, daß ich klug sei, und manchmal, daß ich dumm sei. Ähnlich erging es mir später auch mit Leuten, die nicht zur Familie gehörten und mich auch nicht so liebten wie meine Familie; manchmal war ich »klug« und manchmal »dumm«. Zuerst verstand ich nicht, worin der Unterschied bestand. Ich konnte in meinen Unternehmungen keine Unterschiede erkennen. Allmählich lernte ich dann aber, daß »klug« oder »dumm« nicht davon abhing, wie ich meine geplanten Unternehmungen betrachtete, sondern »klug« und »dumm« hingen davon ab, was dabei herauskam. Das war verwirrend für mich, weil ich vor Beendigung meiner Unternehmungen nie wußte, was dabei herauskommen würde. Ich machte bestimmte Sachen ja gerade deshalb, um zu sehen, was geschehen würde. Wie konnte ich also »klug« sein, wenn das Ergebnis einmal so, und »dumm« sein, wenn es ein anderes Mal anders lautete? Mir scheint, daß ich doch jedesmal dieselbe blieb.
Später lernte ich, vor allem in der Schule, »Erfolg« hoch zu bewerten und »Mißerfolg« zu verbergen, so daß man mich nicht verachtete oder sich über mich lustig machte. Das war nicht der Weg, auf dem ich mich befunden hatte, als beides interessant war und Mißerfolg manchmal anregender war als Erfolg, weil das mehr Fragen aufwarf. Als ich meinen Sinn änderte und meinen Mißerfolg verbarg - dabei auch noch sehr clever war -, bemerkte ich die Fragen nicht mehr.
Wenn Carl Rogers über Werte schreibt, »die von anderen Individuen übernommen und verinnerlicht und als die eigenen angesehen werden,« bezieht er sich auf einen zentralen Konflikt, der manchmal zu einem mörderischen Schlachtfeld werden kann. Auch ich machte den üblichen Fehler, indem ich glaubte, daß alles, was in meinem Kopf vorging, ich selbst war. Noch im Alter von 56 Jahren, zu einer Zeit, da ich einen Großteil dieses Problems geklärt hatte, geriet ich wegen einer Geldangelegenheit eine Woche lang in eine schmerzhafte Klemme. Mein Nacken war verspannt und mein Kopf schmerzte unerträglich, weil sich zwei gegensätzliche Ansichten in meinem Kopf stritten und ich mich nicht entscheiden konnte. Ich war so kampfesmüde, daß es mir gleichgültig war, welche Seite gewann, wenn nur der verfluchte Kampf aufhören würde. Doch für welche Seite auch immer ich mich entschied, ich fühlte mich schuldig. Dann hatte ich einen Traum, der mir in seiner eigenen Sprache erzählte, daß die zwei sich streitenden Ansichten beide nicht von mir stammten. In Wirklichkeit handelte es sich um eine Schlacht zwischen meinem Vater, der nie Schulden vergaß, ob es seine eigenen oder die eines anderen waren, und zwischen meinem Onkel, der sich nie an Schulden erinnerte, bis man ihn darauf aufmerksam machte, und dem sie dann unerheblich schienen. Keine von beiden war meine eigene Einstellung zum Geld. Was ich über Geld dachte, hatte mit dieser speziellen Angelegenheit zu tun, bei der es einige ungewöhnliche Faktoren gab. Es erschien mir phantastisch, daß ich mich eine Woche lang in einer Schlacht zermürbt hatte, die in Wirklichkeit zwischen zwei Männern stattfand, mit denen ich zwanzig Jahre lang sehr wenig Zeit verbracht hatte und die beide tot waren.
Wenn Carl Rogers davon spricht, einen Menschen zu »schätzen«, und das Gefühl vermittelt, daß »dieser Mensch wertvoll ist«, dann werde ich unsicher, daß dies mißverstanden werden könnte als eine Art Lob, als Zuweisung eines hohen, besonderen Wertes. Das bedeutet es für mich nicht, sondern etwas, das schwieriger zu beschreiben ist; es handelt sich nicht um Lob, nicht um Tadel, gleichzeitig meint die Bezeichnung aber auch nichts neutrales, flaches oder mittelmäßiges.
Für mich kommt Rogers' Ansicht der Gleichheit nahe, die ich von Herbert Talehaftewa, einem Hopi, lernte, der im Reservat eine Art Bezirksrichter war. Er arbeitete als Zimmermann bei einer Baufirma, wo ich Geschäftsführerin war. Cab, der Eigentümer und Chef, war ein Snob aus Boston, der auf jeden herabschaute und die Leute soweit erniedrigte, bis sie völlig aufgelöst waren und sich nur sehr mühsam wieder zusammennehmen konnten. Eines Tages sah ich diesen Mann, wie er in der eben beschriebenen Art den Hopi ansah und mit ihm sprach. Cab war ein kleiner Mann, und der Hopi war ziemlich groß und breit, aber Cab schaffte es trotzdem, auf den Hopi herabzusehen. Ich sah, wie der Hopi Cab so gleichberechtigt ansah, daß er Cab auf seine eigene Höhe herabzog - genau dorthin, und kein bißchen tiefer -, so daß sie wie zwei Leute wirkten, die Aug in Aug dastanden. Ich war davon so beeindruckt, daß ich zu dem Hopi hinaufsah, als ob er eine Art Gott wäre. Der Hopi wandte sich mir zu mit derselben starken Gleichberechtigkeit in seinem Blick, und ich fühlte mich heraufgezogen, bis wir auf der gleichen Ebene waren. Durch ihn wußte ich, daß alle Menschen gleich sind, wenn wir sie nur so betrachten würden.
Diese Gleichheit ist es, die »das Schätzen« und »dieser Mensch ist wertvoll« für mich bedeutet - nicht außergewöhnlich, dennoch gleichzeitig einzigartig, aber gleich mit mir selbst, die ich auch nicht außergewöhnlich bin und doch wertvoll und einzigartig. »Du bedeutest mir etwas, so wie ein Mensch dem anderen etwas bedeutet.« - »Du bist für mich so interessant, wie ich es für mich bin.« Unterschiede im Aussehen, Geschlecht, Kleidung, Sprache, Alter, Erziehung, Hintergrund - sie alle verschwinden bzw. sind unwesentlich, obwohl sie da sind. Wir befinden uns in direkter Kommunikation miteinander - von Mensch zu Mensch.
Zu der Zeit der Begebenheit mit dem Hopi war meine Arbeit als Geschäftsführerin zeitweilig außer Kraft gesetzt, weil ich dreimal am Tag für ein Dutzend Hopi-Männer kochte, die auf dem Bau arbeiteten. Die Köchin, eine Tewa-Indianerin, hatte ihre Hand sehr schwer verbrannt und durfte sie zehn Tage lang nicht benutzen. Ich hoffte, daß meine Kochkünste den Hopi-Männern zusagten, aber ich wußte es nicht. Eines Tages sagte Herbert Talehaftewa, zuhause Bezirksrichter, ruhig zu mir: »Die Männer sagen, daß Sie Ihr Bestes geben.« Ich war verletzt. Mir schien, sie dachten, daß mein Kochen nicht sehr gut sei. Aber dann erkannte ich, daß das, was die Männer gesagt hatten, die einfache Wahrheit war und daß ihre Anerkennung dieser Wahrheit schöner war als Lob. Sie kannten mich innerlich. Und ist es nicht so, daß wir uns alle wünschen, so erkannt zu werden, gleichgültig welche Blockaden und Barrieren wir dagegen auftürmten?
Auch ich lernte sie innerlich kennen, von Mensch zu Mensch; und wenn ich fünfzehn Jahre später, mit nur spärlichen Nachrichten dazwischen, davon höre, daß etwas in ihrem persönlichen Leben gut oder schlecht gegangen sei, fühle ich das tief in mir, wahrhaft wissend, was es für sie bedeutet, für jeden Mann in seinen eigenen Begriffen und gleichzeitig für uns in unseren Begriffen - für die ganze menschliche Rasse. Ich bin nun jenen Hopi-Männern, die ich fünfzehn Jahre lang nicht gesehen habe, näher als vielen Leuten, die jetzt um mich sind, mich kategorisiert und in eine Schublade gesteckt haben, Leute, die mich innerlich überhaupt nicht kennen. Ich würde nicht zögern, irgendeinem der Hopi-Männer meine Sorgen, gleichgültig welche, zu erzählen, weil sie diese Sorgen einfach akzeptieren und nicht versuchen würden, mir einen Rat zu geben. Die Hopi-Männer würden mich auf eine teilnehmende Art akzeptieren, die keine Unterschiede macht.
Vor einem Jahr - zu Neujahr - sprach ich mit einem Navajo, der »Glückliches neues Jahr« zu mir gesagt hatte. Ich fragte ihn, ob er der Ansicht sei, daß das neue Jahr ihm Gutes bringen oder ob es eher wie mein eigenes Leben werden würde: »Ich denke, meine Niedergeschlagenheit endet nie - und dann ändern sich die Dinge. Alles geht gut, und ich denke, daß jetzt endlich alles gut ist - und dann stimmt es doch nicht.« Er nickte und sagte schlicht: »Wie bei uns.« Er akzeptierte völlig, daß das Leben für uns beide dasselbe sei, obwohl ich nie gehungert habe wie er, nie wie er im Gefängnis gewesen und niemals gezwungen worden war, mich der Übermacht einer anderen Kultur zu unterwerfen. Daß dies die Wahrheit ist, habe ich erfahren, als ich einer Frau zuhörte, die mir in drei Tagen, insgesamt 17 Stunden, ihr Leben erzählte. Ihr Leben war so »verschieden« von meinem wie meins von dem der Navajos. Wir besaßen sehr wenig und das meiste davon aus zweiter Hand. Diese Frau war in ein Leben mit Alten Meistern und einer Yacht mit einer Mannschaft von 28 Männern, mit allem, was damit zusammenhängt, hineingeboren worden. Je länger ich zuhörte, desto sicherer wußte ich, daß es niemals einen Unterschied zwischen dem Leben der Prinzessin und dem Leben des Aschenbrödels gegeben hat. Der innere Zustand ist bei beiden immer der gleiche gewesen.
Die »Gemeinsamkeit«, von der Carl Rogers spricht, bedeutet für mich das, was ich in uns allen, ohne Ausnahme, gefunden habe. Manchmal ist es eine sehr klare Hauptströmung im Leben eines Menchen, obwohl sie durch Nebenströmungen durcheinander gebracht wird. Andere Male hat es sich sehr kurz in einem Menschen gezeigt, wenn durch Streß oder durch Wohlbefinden Schranken fielen. Das ist oft ein Rätsel für mich gewesen: Wer ist er/sie nun wirklich? Wenn andere Leute sagten, daß ein Mensch das sei, was er die meiste Zeit ist, verwirrte mich das, weil es vernünftig schien - und doch: was ein Mensch manchmal privat zeigte, war doch viel kraftvoller, lebendiger, echter. Manchmal waren solche Ergüsse mehr, als ich ertragen konnte: dieses Leiden eines Menschen an dem Bewußtsein seiner Unfähigkeit, das zu werden, was er, wie er weiß, ist. Manchmal war dieses Wissen zart und sanft und sehr traurig.
Wer bin ich nun wirklich? Eine Frau erzählte mir, daß ihr eines Tages, als sie bei einem Fußballspiel eine Fahne schwenkte und jubelte, die Hand, die die Fahne hielt, in den Schoß fiel und sie inmitten der tobenden Menge dachte: »Warum mache ich das? Fünfzehn Jahre lang habe ich keine Freude daran gehabt.« Was war echt - die fünfzehn Jahre oder dieser Moment?
Das Wissen um das Echte in einem anderen Menschen, seine verzweifelte Sehnsucht, nicht verletzend, liebevoll, verantwortungsvoll, aufbauend (oder kreativ) und mit anderen eins zu sein - dies scheint mir eine Erklärung dafür, warum ein Mensch gegen alle Vernunft und nicht unbedingt aufgrund besserer Einsicht bei einem anderen bleibt. Eine sehr einfache, »ungebildete« Frau, die allen Grund hatte, ihren Mann zu verlassen, erzählte mir unter Tränen, wobei sie mit ihrem ganzen Sein an mein Verständnis appellierte: »Er möchte gut sein.« Mütter kennen dies oft von ihren Kindern und verteidigen die Kinder - nicht ihr Verhalten -, wenn sie zerstörerisch sind.
Sich nach etwas zu sehnen, bedeutet, es zu schätzen. Ich weiß, daß wir alle, ohne Ausnahme, diese Sehnsucht, »gut zu sein«, in uns haben. Ich habe diese Sehnsucht in einem britischen Adeligen erkannt. Ich habe sie bei einem Mann wiedergefunden, der einen Lastwagen entführt, einen Indianer betrunken gemacht und ihn vom fahrenden Lastwagen geworfen, einen Esel überfahren und getötet und die Heizung zertrümmert hat und dann solange weitergefahren ist, bis der Motor ausbrannte und er selbst im Gefängnis landete, während seine vier kleinen Kinder allein zu Hause waren, weil ihre Mutter im Krankenhaus lag und ein fünftes bekam. Ich konnte es erreichen, daß er aus dem Gefängnis kam, so daß er sich um seine Familie kümmern konnte, und er erreichte es, daß mir meine Arbeit gekündigt wurde.
Ich kannte diese Sehnsucht auch bei meinem Mann, der sich 1945 das Leben nahm. Vor seinem Selbstmord lebte ich mit dem Wissen, daß er unseren Sohn und mich umbringen könnte, uns beide, die er liebte, und daß er andere Menschen ernstlich verletzen könnte, was er überhaupt nicht wollte. Es erschien mir so, daß er, um aufhören zu können, andere Menschen zu verletzen und ständig anders zu handeln, als er eigentlich wollte, den Selbstmord als einzigen Ausweg aus diesem Dilemma betrachtet hatte.
Ich weiß, daß es diese Gemeinsamkeit gibt, von der Rogers spricht. Ich habe sie mir mein ganzes Leben lang gewünscht, und mir wurde immer erzählt, das sei unmöglich. Doch im Dezember 1941 erfuhr ich, wie das ist, wenn man mit dieser Gemeinsamkeit lebt, und wie gut es ist, wenn jeder nach seiner eigenen Menschlichkeit reagiert und nicht durch all die oberflächlichen Wertvorstellungen, mit denen wir leben, vergiftet ist. (Die einzige Ausnahme von dieser Erfahrung waren zwei sehr neurotische Männer und ein paar geistesschwache alte Leute, die nicht begriffen, was vorging.) In der Woche nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor erwartete das Militär auf Hawaii eine Invasion als Folge dieses erfolgreichen Angriffs. Sie glaubten, daß die Japaner nach Berichterstattung ihrer Flieger an ihre Flugzeugträger mit anderen Schiffen und Truppen landen bzw. einmarschieren würden. Wir wußten, daß wir niedergewalzt werden würden, daß wir nichts hatten, um zu kämpfen, und daß nach Ansicht des Militärs nicht mehr als 2000 Mann nötig seien, um die Insel einzunehmen - so lautete ein Gerücht.
Die Invasion wurde in der Zwanzig-Meilen-Zone, dort wo ich lebte, erwartet. Wir rechneten nicht damit zu überleben.
Alle Verabredungen irgendwelcher Art waren abgesagt worden. Alle Alltäglichkeiten waren so plötzlich weggewischt, daß ich, als ich am Montag morgen vor die Tür ging und Milchflaschen auf den Stufen sah, »die Milch« sagte, völlig erstaunt darüber, daß noch irgendetwas so sein konnte wie vorher.
Wo auch immer ich mich aufhielt, schienen die Menschen - Japaner, Chinesen, Hawaiianer, Portugiesen, Haolen (Weiße) - mit einem Heiligenschein behaftet, von dessen Existenz sie selbst nichts wußten. »Darf ich Ihnen etwas abgeben?« (also: »Ich habe zuviel.«) »Kann ich nicht irgendetwas für Sie tun?« Sanfte Fragen, ehrlich gemeint, ohne aber hartnäckig zu sein.
Es fällt mir schwer, hier weiter zu schreiben. Tränen verschleiern mir die Sicht, egal wie oft ich sie fortwische. Ich schluchze, und das schüttelt mich so, daß ich nicht mehr richtig tippen kann. Ich habe das Gefühl: »Was soll das? Welche Möglichkeit habe ich, es zu vermitteln?«
Manche Leute ernteten mit ihren Kindern Macademianüsse. Es spielte für niemanden eine Rolle, auf wessen Land sie wuchsen oder wer sie aß.
Als ich den kleinen japanischen Gemüseladen betrat, wo Mr. Yoshimoto und ich über alles diskutiert hatten, von der Schwierigkeit, in Japan guten Kaffee zu bekommen, bis hin zur internationalen Politik, schaute er auf und sagte: »Ich denke, jetzt Sie und Mr. Lindbergh nicht können sprechen.« Wir lachten zusammen. Die anderen Japaner im Geschäft lachten freundschaftlich mit uns, mit Ausnahme von einem Mann, der gerade nach mir hereingekommen war. Er wickelte die Schnürsenkel, die in einer Schachtel auf dem Ladentisch standen, um seine Finger. Mr. Yoshimoto fragte ihn, mit der Intuition, die wir damals alle hatten: »Ihr Sohn?« - »Ich nicht weiß,« sagte der Mann. »Er Koffer nehmen. Pearl Harbor gehen.« Er fuhr fort, die Schnürsenkel um seinen Finger zu wickeln.
Wir alle waren still - nicht, um »Achtung zu zeigen«, oder um »zu versuchen, für den anderen zu fühlen.« Ich hatte den Mann nie gesehen. Ich wußte nur, daß er sagen wollte, daß nach dem ersten Angriff, als alle zivilen Arbeiter über den Rundfunk gebeten wurden, sofort nach Pearl Harbor zu kommen, sein Sohn gegangen war. Wir hatten gehört, daß die Wachen am Eingang von diesem Aufruf nichts gewußt und daher geschossen hatten, als Männer, viele von ihnen Japaner, schnell auf das Tor zugefahren waren.
Aber was dieser Mann für seinen Sohn fühlte, fühlten und wußten wir alle. Man kann es nicht beschreiben. Wie würden Sie sich fühlen? Wir wußten es alle, als wir in äußerstem Stillschweigen bewegungslos dastanden. Sogar mein sechsjähriger Sohn war still.
Der schnelle Übergang, der damals stattfand, von unserem Gelächter bis zu unserem Schweigen, passierte ständig, wo auch immer wir gerade aufeinander reagierten. Vieles war lustig, vieles war traurig. Es konnte geschehen, daß man - fröhlich - mit der Spur eines Lächelns in den Augen ausging, ein Lächeln, das durch einen Blick in die Augen oder auf die Körperhaltung eines anderen wie weggewischt sein konnte. Man streckte seine Hand aus und berührte jemanden, ohne zu wissen, warum; man nahm Anteil.
Der Mutter, die anfing, ihr Kind zu schelten, kam der Gedanke: »Was hat das für einen Sinn?«
Es kam vor, daß eine Mutter, deren sanfter Umgang mit ihrem Kind von einer gewissen Schmerzlichkeit begleitet war, in den Augen des Kindes Furcht wahrnahm. Sofort änderte sie ihre Haltung und wurde wieder bestimmend oder fröhlich; die Furcht in den Augen des Kindes war verschwunden.
Ich kannte keinen, der während jener Woche vorgab, keine Angst zu haben; vor Kindern wurde diese Angst jedoch verborgen. Hier und da waren Soldaten mit Gewehren postiert, hinter ein paar Sandsäcken, die kaum über ihre Fußgelenke hinaus ragten, jedenfalls nie bis an die Knie reichten. Das schien den Grad unseres Schutzes zu symbolisieren. Wir fühlten, daß wir schutzlos waren. Wenn wir ein Flugzeug hörten, war es beinahe sicher, daß es ein japanisches war. Mir schien, daß ich in einem Iglu in Alaska überglücklich sein würde, wenn ich nur weit weg vom Krieg wäre.
Und dennoch gab es zur gleichen Zeit all das Leben, nachdem ich mich immer gesehnt hatte - das schöne Gefühl aller Menschen überall, die Teilnahme, das Wissen, das Reagieren aufeinander, die Bereitwilligkeit und die fehlende Vereinnahmung von Dingen und Menschen. Ich war während jener Woche nicht auf der Seite der Insel, wo Honolulu liegt, deswegen weiß ich nicht, wie es dort war; aber ein Offizier hat mir erzählt, daß während jener Woche die Kaufleute ihre Läden dem Militär öffneten und den Soldaten mit echter Freundlichkeit und ohne Berechnung anboten, zu nehmen, was immer sie brauchten. »Und dann, am Montag, eine Woche später, als der unmittelbare Schrecken vorüber war …« seine Lippen waren verkrampft, als er das sagte, traurig über das, was verlorengegangen war; und mit einem Hauch Bitterkeit fuhr er fort: »dann kamen die Rechnungen - mit Kriegspreisen.« Auf unserer Seite der Insel behaupteten später fast alle, daß sie keine Angst gehabt hätten - dieselben Leute, die mir eine Woche vorher erzählt hatten, daß sie sich so schrecklich fürchteten.
Glück ereignete sich, als wir ängstlich waren, aber das geschah nicht etwa nur deshalb oder sogar notwendigerweise, weil wir Angst hatten. Menschen können die furchtbarsten Dinge tun, wenn sie Angst haben. Wir aber hatten erwartet, jeden Moment ausgelöscht zu werden, und doch gab es nur das Jetzt, um zu leben. Und das haben wir getan.
Das tut auch Carl Rogers, wenn er mit seinen Klienten zusammen ist, denke ich. Es wäre an der Zeit, daß wir es alle tun. Wir achten so sehr darauf, wo wir leben; wir achten so wenig darauf, wann wir leben.
Fußnote:
* Awareness ist ein zentraler Ausdruck, z.B. in der Gestalttherapie, der im Deutschen nicht genau wiederzugeben ist. Gemeint ist die wache, aufmerksame, bewußte Wahrnehmung dessen, was in einem selbst geschieht und was einem begegnet. Hier werden dafür Ausdrücke wie »Gewahrsein«, »(wache) Bewußtheit« (im Unterschied zu »Bewußtsein« bzw. consciousness) verwendet. (Anm. d. Red.)


Barry Stevens (1902 - 1985) war bereits 65 Jahre alt, als sie 1967 zum ersten Mal Fritz Perls und der Gestalttherapie begegnete.Und als Fritz Perls 1969 die Gestaltgemeinschaft und das Gestalt Intitute of Canada am Lake Cowichan in der Nähe von Vancouver gründete, folgte sie ihm dorthin und begann zusammen mit rund zwanzig weiteren Personen, ihre Gestalttherapie-Ausbildung.
Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Überlegungen aus dieser Zeit bildeten die Grundlage für ihr Buch "Don't Push the River. Gestalttherapie an ihren Wurzeln", dessen deutsche Ausgabe im September 2000 in der Edition des Gestalt-Instituts Köln / GIK Bildungswerkstatt im Peter Hammer Verlag (zusammen mit Beiträgen von Erhard Doubrawa und Detlev Kranz) erschienen ist: Barry Stevens, Don't Push the River. Gestalttherapie an ihren Wurzeln. 261 Seiten, 19,90 Euro (Lieferung auf Rechnung, natürlich versandkostenfrei). Bestellanschrift: Gestalt-Institut Köln, Rurstr. 9, 50937 Köln, Fax. 0221-447652, eMail: gik-gestalttherapie@gmx.de




