



 Stefan Blankertz (Foto: Hagen
Willsch)
Stefan Blankertz (Foto: Hagen
Willsch)
Gibt es eine Gestaltpädagogik?
Auf den ersten Blick mag die Frage, ob es eine Gestaltpädagogik gäbe, irritierend oder sogar arrogant erscheinen. Es gibt Veröffentlichungen, die das Wort »Gestaltpädagogik« im Titel führen oder im Text benutzen. (1) Einige meiner eigenen Veröffentlichungen werden zur Gestaltpädagogik gerechnet. (2) Wie kann man da fragen, ob es eine Gestaltpädagogik gäbe?
Die Frage ist im Zusammenhang der Arbeit an dem »Lexikon der Gestalttherapie« aufgekommen, das ich mit Erhard Doubrawa verfasst habe. (3) Schauen wir uns die Begriffe »Gestaltberatung«, »Gestaltcoaching«, »Gestaltpaartherapie«, »Gestaltsupervision« und sogar »Gestalttherapie« selbst an. In diesen Wortzusammenstellungen bezeichnet »Gestalt« die Anwendung eines bestimmten Konzeptes, nämlich das der »Gestalt«, auf einen Arbeitsbereich, nämlich den der Beratung, Supervision, Therapie usw.
Ganz anders verhält es sich bei dem Begriff »Gestaltpsychologie«. Hier bedeutet »Gestalt«, dass aus diesem Begriff heraus die Psychologie konstituiert wird, also die Wissenschaft (= Logie) von der Seele (= Psyche). Aus dem Begriff der »Gestalt« erwachsen die psychologischen Prinzipien
1. der Wahrnehmung von Sinn (anstelle unverbundener »Daten«),
2. des Prägnantwerdens einer Figur auf einem Hintergrund sowie
3. der Auffassung, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile.
In der Anwendung auf die Therapie folgt aus diesen Prinzipien des »Gestalt«-Konzepts unter anderem, dass Aggression einen zentralen Stellenwert im Lebensprozess einnimmt. Die Wahrnehmung von Sinn bedeutet nämlich immer, dass der Wahrnehmende den Dingen um sich herum Sinn gibt, sie also aus seiner Perspektive heraus umgestaltet. Die Behinderung der aggressiven Energie, der Energie zur Gestaltbildung, ist der Ausgangspunkt psychischer Probleme, die in der Therapie behandelt werden.
Die Frage lautet nun, ob die Pädagogik ein Anwendungsgebiet oder eine Wissenschaft sei. Als Anwendungsgebiet wird der Begriff »Pädagogik« fast ausschließlich im Zusammenhang mit der Institution Schule verwendet. Das Wort »Pädagoge« ist nahezu synonym mit dem des »Lehrers«, meist sogar eingeschränkt auf »Lehrer in einer öffentlichen Schule« – ein Lehrer z.B. an einer privaten Sprachenschule wie Inlingua oder Berlitz wird normalerweise nicht als »Pädagoge« tituliert. Daneben gibt es jedoch die Pädagogik als Wissenschaft von der Hilfestellung beim Aufwachsen, also bei der – in Wilhelm von Humboldts Worten – »höchsten und proportionierlichsten Bildung der Kräfte des Menschen zu einem Ganzen«. (4) Inzwischen ist der Begriff »Pädagogik« zwar dem der »Erziehungswissenschaft« weitgehend gewichen, aber wird immer noch im Sinne der Bezeichnung einer Wissenschaft verwendet.
Schauen wir uns auf dem Hintergrund dieser Überlegung die Entwicklung dessen an, was als »Gestaltpädagogik« bezeichnet wird.
1. Phase: Das Schul-Experiment. In den 1960er Jahren hat Paul Goodman den Kreis um ihn herum dazu angeregt, aktiv in der Alternativschul- bzw. Free-School-Bewegung mitzuwirken. (5) Besonders hervorzuheben ist die im vorliegenden Buch beschriebene »First Street School«. Sie lag in einem New Yorker sozialen Brennpunkt und ist von den Gestalttherapeuten George Dennison und Susan Goodman, eine Tochter Paul Goodmans, 1964 gegründet worden. Weder Paul Goodman noch George Dennsion benutzten den Begriff »Gestaltpädagogik«. Aber ihre Anregungen bilden nach wie vor den Hintergrund und immer noch das – wenn auch bisweilen nur noch versteckt angedeutete – Ideal der heutigen »Gestaltpädagogik«. Allerdings wird dieses Ideal – die eigentümliche Kombination des selbstbestimmten »antiautoritären« Lernens mit dem klaren Bekenntnis zur Abgrenzung und zur Authentizität des erwachsenen Personals – inzwischen eher rituell angerufen, als in einer pädagogischen Theorie reflektiert.
2. Phase: Das Scheitern. Spätestens Mitte der 1970er Jahre musste die Alternativschul-Bewegung in dem Sinne als gescheitert erklärt werden, dass sie versagt hatte, in einem nennenswerten Umfange eine nicht- oder außerstaatliche Alternative zur Institution Schule zu schaffen. Demgegenüber hat die öffentliche Schule ausgewählte Vorstellungen der Alternativschulen aufgegriffen und inkorporiert. Dieses Scheitern ist, so lautet meine These, weder theoretisch aufgearbeitet noch emotional bewältigt worden. Warum das gute, humane und auch allseits akzeptierte Ideal damals nicht hatte umgesetzt werden können, ist den Verfechtern der »Gestaltpädagogik« immer noch nicht klar. Für die Entwicklung einer glaubwürdigen Gestaltpädagogik wäre es m.E. unabdingbar, die Theorie des Scheiterns der Free-School-Bewegung nachzuliefern. Meinen eigenen Beitrag dazu werde ich im Folgenden skizzieren.
3. Phase: Therapie für Lehrer. Der Begriff »Gestaltpädagogik« wurde Ende der 1970er Jahre geprägt und zwar mit dem Hintergrund, dass einige Ideen aus der Alternativschul-Bewegung (wie selbstbestimmtes Lernen usw.) einen Platz in den öffentlichen Schulen erhalten sollten. Der genuine Beitrag der Gestaltpädagogik bestand darin, nicht einfach die Forderung nach einem idealen Unterricht zu stellen, sondern darauf zu achten, wie die Lehrer psychisch (und nicht nur didaktisch) darin unterstützt werden könnten, einen solchen Unterricht auch durchzuführen. Dies war sehr notwendig, weil die Lehrer zwischen renitenten Schülern, behindernder Bürokratie und Querelen unter Kollegen vielfach zusammenbrachen und immer noch zusammenbrechen. Der Ansatz, die Lehrer psychologisch zu unterstützen, wurde in der Folge weiterentwickelt und stellt die dritte, bis heute anhaltende Phase der Gestaltpädagogik dar. Sie ist im Wesentlichen ein »Überlebenstraining für Lehrer«. Dies ist eine wichtige Funktion, aber keine eigentlich pädagogische, sondern eine therapeutische. »Gestaltpädagogik« ist dergestalt Gestalttherapie für Lehrer.
Fazit dieser Betrachtung ist, dass »Gestaltpädagogik« in ihrer gegenwärtigen Form ebenso ein spezielles Anwendungsgebiet der Gestalttherapie ist wie z.B. »Gestaltsupervision«: Im Bereich der Pädagogik, also bei Lehrern der öffentlichen Schule, wird mit der gestalttherapeutischen Haltung Unterstützung angeboten. Für eine »Gestaltpädagogik« im Sinne der Konstituierung der Wissenschaft vom Heranwachsen aus dem Begriff der Gestalt stehen die Chancen demnach schlecht.
Auf der anderen Seite findet sich bei Erving und Miriam Polster an einigen Stellen der Hinweis auf eine »Gestalt-Lerntheorie«. (6) Angesichts der Tatsache, dass der Begriff »Pädagogik« im Amerikanischen sehr selten verwendet wird – außer Paul Goodman ist mir kein Autor bekannt, der das tut –, kann man den Hinweis auf eine »Gestalt-Lerntheorie« durchaus als ein Indiz für eine »Gestaltpädagogik« im Sinne der Wissenschaft nehmen. Macht man sich allerdings auf die Suche nach der »Gestalt-Lerntheorie«, auf die die Polsters hinweisen, so findet man nichts. Der Hinweis der Polsters zielt nicht auf eine existente Gestalt-Lerntheorie, die man irgendwo nachlesen kann, sondern ist bestenfalls als Aufforderung zu verstehen, eine solche zu formulieren.
Im Folgenden werde ich im ersten Teil meine Theorie des Scheiterns der Alternativschul- bzw. Free-School-Bewegung darlegen und im zweiten Teil Ansätze zu einer u.a. von George Dennison angeregten Gestaltpädagogik entwickeln.
Die Theorie des Scheiterns der Alternativschul-Bewegung steht darum am Beginn und ist darum in ihrer Ausführlichkeit so wichtig, weil nur sie es vermag, den (gestalt-)pädagogischen Gedanken von Goodman, Dennison und ihren Mitstreitern, Vorgängern und Nachfolgern zu retten: Nur wenn es gelingt, das Scheitern auf andere Weise als durch das eigene Versagen zu erklären, könnte das den (gestalt-)pädagogischen Gedanken davor bewahren, als »utopisch« oder »praxisuntauglich« abgetan zu werden.
Theorie des Scheiterns
Daran, dass die Hoffnungen der Alternativ- bzw. Free-School-Bewegung, die George Dennison in dem vorliegenden, 1969 verfassten Buch zum Ausdruck bringt, gescheitert sind, gibt es wie gesagt keinen Zweifel, obwohl das Image der öffentlichen Schulen seit Mitte der 1960er Jahre nicht besser geworden ist. (7) (Vielen Konservativen erscheint heute im Rückblick sogar, dass zu jener Zeit die Schulwelt noch in Ordnung gewesen sei!) Michael Rossman, ein führender Vertreter der Free-School-Bewegung in den USA, hatte 1972 vorausgesagt, dass es 1975 an die 25.000 bis 30.000 Free Schools mit rund
2 Millionen Schülern geben werde. Stattdessen stagnierte die Zahl der Free Schools auch in den USA bei wenigen Tausend. In Deutschland hat die »Freie Schule Frankfurt« nach jahrelangen Prozessen eine Sonderzulassung mit Bestandsschutz erhalten, (8) ebenso wie einige wenige andere Überbleibsel aus der »antiautoritären« Zeit. Derzeit gibt es wieder eine Handvoll illegaler freier Schulen in Deutschland, aber von einem nennenswerten Einfluss kann keine Rede sein. Die wenigen Erziehungswissenschaftler und Bildungsökonomen, die es angesichts dessen überhaupt für Wert hielten, sich mit Free-School-Gedanken und radikaler Schulkritik aus den USA zu beschäftigen, haben aus dem Scheitern der Bewegung zwei zentrale Thesen abgeleitet: (9)
1. Ein Netz von dezentralen, nicht-öffentlichen und an den Bedürfnissen der Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern) orientierten Schulen sei nicht in der Lage, eine stabile Grundlage für die Versorgung der Gesamtgesellschaft mit den ökonomisch, politisch, sozial und kulturell notwendigen Bildungsgütern zu schaffen. Die Schulen würden zu leicht und zu schnell zerfallen. (Beleg im vorliegenden Buch: Am Ende der zwei Jahre als Lehrer in der First-Street-School schreibt George Dennison, er habe »die Nase voll« von Kindern.) Überdies gäbe es kaum oder wenig Möglichkeiten, sicherzustellen, dass diese Schulen einen Mindeststandard erreichen.
2. Nicht-öffentliche Schulen könnten die soziale Ausgewogenheit nicht garantieren. Sie stünden entweder nur »den Reichen« offen, die es sich leisten können, Schulgeld zu bezahlen, oder sie seien auf zusätzliche öffentliche Mittel bzw. Spenden angewiesen. Auch damit würden sie für Instabilität anfällig, wie ebenfalls an der First-Street-School und ihrer Unfähigkeit abgelesen werden kann, nach den zwei Jahren ihrer Existenz die weitere Finanzierung aufrecht zu erhalten.
Nicht nur die Kritiker der Free-School-Bewegung, sondern auch deren Befürworter haben einen ökonomischen Mechanismus nicht zur Kenntnis genommen, auf den Milton Friedman schon Mitte der 1950er Jahre hingewiesen hat: Die fehlende Möglichkeit von Alternativen zur öffentlichen Schule liegt darin begründet, dass die öffentlichen Schulen ihre Einkünfte aus gesicherten Steuern beziehen, während die Alternativschulen darauf angewiesen sind, dass die Menschen über das in den Steuern enthaltene Schulgeld hinaus bereit sind, in das Wohlergehen ihrer Kinder zu investieren. Um die Chancen fair zu verteilen und eine Konkurrenz zwischen staatlichen (»öffentlichen«) und privaten Angeboten herzustellen, schlug Friedman vor, das Bildungsbudget in Form von Gutscheinen an die Eltern zu verteilen, die sie an den Institutionen ihrer Wahl einlösen könnten. (10) Konkret würde das dann so aussehen: Die Eltern von José, Eléna, Maxine usw. hätten das Geld, das der ihren Kindern zustehende Platz an einer öffentlichen Schule kosten würde, in Form eines Gutscheins in die Hände bekommen. Wenn ihre Kinder nicht die öffentliche Schule besuchten, hätten sie die Gutscheine z.B. an die »First Street School« (oder eine andere Einrichtung ihrer Wahl) geben können. Sofern es den Betreibern der »First Street School« gelungen wäre, die Kinder und deren Eltern kontinuierlich von ihrer Sinnhaftigkeit zu überzeugen, hätte es nie ein Finanzierungsproblem gegeben.
Dieser einfache, praktikable, ausgewogene und in keiner Weise radikale Vorschlag wird besonders in der deutschen Erziehungswissenschaft fast einhellig abgelehnt und inhaltlich wenig diskutiert. Erfahrungen mit Gutscheinversuchen werden nicht aufgearbeitet, höchstens wird am Rande bemerkt, sie seien »gescheitert«. Erziehungswissenschaftler, Pädagogen und Bildungspolitiker, die in den 1970er Jahren die »Emanzipation vom repressiven System« gefordert haben oder die sich heute in der Tradition dieser Forderungen sehen, werden angesichts des von Friedman vorgeschlagenen Gutscheinkonzepts zu entschiedenen Verfechtern einer öffentlichen Schule, die den unwissenden Schülern und hilflosen bis böswilligen Eltern gegenüber wenigstens darauf bestehen könne, das »richtige Bewusstsein« zu vertreten.
Die Beschäftigung mit Friedmans Gutscheinmodell ermöglicht es, einen ökonomischen und politischen Rahmen für die pädagogische Freiheit des Experimentierens und der selbstorganisierten Bildung zu denken, den die Alternativ- und Free-School-Bewegung zur Entfaltung gebraucht hätte und an dessen Nichtexistenz sie gescheitert ist. Dabei hat sie zu diesem Scheitern insofern selbst beigetragen, als sie von wenigen Ausnahmen (wie z.B. Christopher Jencks (11)) abgesehen sich mit Finanzierungsfragen nicht ernsthaft auseinandergesetzt hat.
Unter den inzwischen zahlreichen Gutscheinversuchen beschäftige ich mich nun mit zwei gut dokumentierten Erfahrungen, die mir für die Diskussion besonders interessant erscheinen.
Bildungsgutscheine in Chile
Das größte Experiment mit den von Milton Friedman vorgeschlagenen Bildungsgutscheinen findet in Chile seit 1980 statt. Dieses Experiment wird von Gegnern der Entstaatlichung im Schulwesen bisweilen als Beispiel ins Feld geführt, um so mehr, da Chile noch der Geruch der faschistischen Militärdiktatur anhaftet. Ich brauche auf diesen Aspekt hier jedoch nicht weiter einzugehen, weil in Chile das System der Bildungsgutscheine auch nach dem Ende der Militärdiktatur fortbesteht.
Öffentliche Schulen sind in Chile Angelegenheit der Gemeinden: Die Gemeinden erhalten finanzielle Mittel des Zentralstaates in Abhängigkeit von der Schülerzahl ihrer Schulen. Die öffentlichen Schulen sind bezüglich ihrer Binnenstruktur (z.B. Anstellung von Lehrern) autonom. Private Schulen erhalten den gleichen Betrag pro Schüler, wenn die Schulen entsprechend anerkannt sind und wenn das Einkommen der Eltern der Schüler unter einem gewissen Limit liegt. Alle Schulen in Chile – öffentliche, private gutschein-subventionierte und private nicht-subventionierte Einrichtungen – sind am Ende der Pflichtschulzeit (achtes Schuljahr) gehalten, ihre Schüler an einem standardisierten Leistungs- und Fähigkeitstest teilnehmen zu lassen.
Ein Vergleich der Testergebnisse zwischen den öffentlichen und den gutschein-subventionierten privaten Schulen ergibt nach Ansicht einiger Statistiker keine deutliche Überlegenheit der privaten Schulen, z.B. Patrick McEwan und Martin Carnoy (2000); andere Statistiker sehen allerdings sehr wohl eine solche Überlegenheit, z.B. Caroline Hoxby (1994) und Dante Contreras (2002). (12) Aus den – in ihrer Faktengrundlage allerdings anzweifelbaren – Behauptungen von Patrick McEwan und Martin Carnoy ist die Schlussfolgerung abgeleitet worden, dass private Schulen entgegen der Erwartung von Milton Friedman keine höheren Leistungen als öffentliche Schulen hervorbringen würden.
Ungeachtet der Frage, welche Statistiker recht haben, ist die Schlussfolgerung nicht zwingend: Die öffentlichen Schulen sind in Chile echten Marktbedingungen unterworfen, d.h. sie haben keinen Vorteil gegenüber der privaten Konkurrenz. Die öffentlichen Schulen stehen im fairen Wettbewerb mit den privaten Schulen. Darum ist es anzunehmen, dass auch öffentliche Schulen sich verbessern oder aber eben vom Markt verschwinden. Diesen Effekt nenne ich nach dem Erfinder des Gutscheinsystems, Milton Friedman, den »Friedman-Effekt«. Dieser Effekt zeigt sich auch im Wisconsin-Experiment, das im nächsten Abschnitt dargestellt wird. Dass der »Friedman-Effekt« in Chile greift, wird auch von den durchschnittlichen Testergebnissen belegt, die mit Ausnahme eines kurzen, erklärungsbedürftigen Einbruchs Ende der 1980er Jahre kontinuierlich von 1980 bis 1996 angestiegen sind. In der Tat stimmen nach meiner Übersicht alle Beobachter – auch die ausgesprochenen Kritiker der Privatschulen – darin überein, dass das chilenische Schulsystem aufgrund der Regionalisierung und aufgrund der Schulautonomie große Fortschritte gemacht hätte. (13)
In Zeiten angespannter öffentlicher Kassen wird mit dem Gutscheinsystem auch die Hoffnung verbunden, hohe Qualität zu günstigeren Preisen zu bekommen. Was sagt das chilenische Beispiel bezogen auf die Kostenfrage Patrick McEwan und Martin Carnoy gehen davon aus, Chile würde zeigen, dass private Schulen nicht kostengünstiger arbeiten würden als öffentliche Schulen. Um das im chilenischen Kontext herauszufinden, braucht man jedoch keine Statistik. Denn obwohl die Schulen um Schülerzahlen konkurrieren, konkurrieren sie nicht mittels eines niedrigen Preises – denn die Pro-Kopf-Summe für jeden Schüler ist nicht variabel. Mit anderen Worten: Es gibt gar keinen Anreiz, Schuldbildung günstiger anzubieten. Diesen Effekt nenne ich den »Niskanen-Effekt« nach dem Ökonomen William Niskanen, der das Nachfrageverhalten öffentlichen Gütern gegenüber systematisch erfasst hat: Nach dem Niskanen-Theorem werden kosten- und gebührenfrei zur Verfügung gestellte (öffentliche) Güter so nachgefragt, als ob sie tatsächlich keine Ressourcen beanspruchen würden. Damit kommt es zu einer Überkonsumption öffentlicher Güter bei dem gleichzeitig vorherrschenden Gefühl, es gäbe von ihnen »zu wenig« (Freibier-Effekt). In Bildungssystemen von Entwicklungsländern, in denen Privatschulen einen Anreiz für niedrige Kosten haben, lassen sich dagegen Einsparungen zwischen 20% und 80% beobachten. (14)
Zu einer Frage der Werthaltung kommt es in einem anderen Streitpunkt bezüglich des Chile-Experimentes. Es zeigt sich, dass die Wahlmöglichkeit der Eltern in Chile tendenziell zu verschiedenen Segregationen (»Absonderungen«) führt. Die öffentlichen Schulen werden von Kindern besucht, deren Eltern durchschnittlich einen etwas geringeren Sozialstatus haben als die Eltern der Kinder, die zu privaten gutschein-subventionierten Schulen gehen. Unter den Privatschulen gibt es überdies katholische, protestantische und anderswie weltanschaulich oder religiös geprägte Schulen.
Dies wird von Pädagogen, die die Hauptaufgabe der Schule in der »Integration« sehen, abgelehnt. Jedoch lässt sich feststellen, dass erzwungene Integration zu größeren Problemen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen führt. Freiwillige Segregation führt paradoxer Weise zu mehr Integration als erzwungene Integration. Diesen Effekt nenne ich den »Mises-Effekt« nach Ludwig von Mises, der darauf in seinem Buch »Liberalismus« (1927) hingewiesen hat. Übrigens: Im nordamerikanischen Kontext weisen öffentliche Schulen eine größere Segregation auf als private. (15) Die starke Segregation im öffentlichen US-Schulsystem hat sich seit den Tagen, die George Dennison beschreibt, nicht reduziert – ganz im Gegenteil ist sie nach, trotz und vielleicht durch die großangelegten teuren Integrations-Maßnahmen nur noch schlimmer geworden. (16)
Ein spezieller Kritikpunkt innerhalb des Segregations-Vorwurfs besagt zudem, dass die Kinder engagierter Eltern von der Möglichkeit profitieren, eine Schule ihrer Wahl zu besuchen, während die übrigen Kinder »zurückbleiben«. Dies wäre vor allem die Folge davon, dass gute Schüler in guten Schulen zusammen kämen und sich dort gegenseitig förderten. Um diesem Effekt entgegen zu wirken, vertreten manche Kritiker die Meinung, (17) die Zusammensetzung der Schulen sollte durch »Zufall« bestimmt sein, um eine Durchmischung der Bevölkerung zu erreichen. Die Frage darf jedoch erlaubt sein, ob guten Schülern tatsächlich auferlegt werden sollte, dass ihr Lernerfolg durch störende, unzufriedene und schlechte Klassenkameraden behindert wird. Die Erlaubnis, Schüler abzulehnen, die nicht in das Konzept einer Schule passen, ist eine Grundvoraussetzung für vernünftige Pädagogik: Jeder weiß, dass ein paar Störenfriede oder Uninteressierte genügen, um jeden sinnvollen Unterricht zu sabotieren. Dies nenne ich die »Goodman-Hypothese«. (18) Stellen wir uns einfach mal vor, George Dennison hätte den renitenten Stanley nicht der Schule verweisen dürfen! Eine weitere Anmerkung zum Chile-Experiment folgt aus der Goodman-Hypothese: In Chile herrscht trotz allem dennoch Zwangsschule mit Schulpflicht bis zum achten Schuljahr und Berechtigungswesen als Voraussetzung für den Berufszugang. Der Hypothese Goodmans zufolge ist die Schule jedoch nicht der beste Lernort für alle Kinder. Diejenigen Kinder, die im Kontext des chilenischen Gutscheinsystems »zurückbleiben«, sind eventuell als Opfer der Schulpflicht anzusehen. Ihre Zeit wird verschwendet sowie das Geld ihrer Eltern. Denn die Gutscheine werden schließlich aus Steuermitteln bezahlt, sodass wie überall sonst im Staatsschulsystem der Schulbesucht nur kostenlos zu sein scheint. »There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch« (TANSTAAFL) sagt Milton Friedman: Umsonst ist nichts.
Alles in allem scheinen mir die Kritiker des chilenischen Gutscheinsystems von Testergebnissen besessen zu sein. (19) Über den Lebenserfolg, den die Schüler der Schulen haben, gibt es keine mir bekannten Statistiken. Wohl aber gibt es Statistiken über die Zufriedenheit der Schüler, Lehrer und Eltern mit ihren Schulen: In allen Systemen, die freie Schulwahl ermöglichen (nicht nur in Chile), ist diese Zufriedenheit extrem hoch. Ich finde, das wichtigste Kriterium in der Beurteilung von Bedingungen des Aufwachsens sollte sein, wie zufrieden alle Beteiligten sind – darin eingeschlossen ist natürlich, dass eine Schule ihren Schülern dabei helfen soll, im weiteren Leben gut klar zu kommen.
Bildungsgutscheine für »Unterprivilegierte« in Wisconsin
Der sozialpolitische Effekt der Bildungsgutscheine kann noch genauer in einem Experiment in Wisconsin, USA, beobachtet werden. Die Ökonomin Caroline M. Hoxby hat dieses Experiment wissenschaftlich begleitet. (20) Das Experiment in den 1990er Jahren sah vor, dass die Eltern von sozial benachteiligten Kindern in Brennpunktgebieten das Geld, das der Staat für Schulbildung aufwenden würde, in Form von Gutscheinen bekommen. Diese Gutscheine konnten sie an einer Institution ihrer Wahl einlösen. Im Gegenzug erhielten die öffentlichen Schulen der an dem Experiment beteiligten Bezirke keine direkten öffentlichen Zuwendungen mehr, sondern nur im Verhältnis zu der Zahl der Kinder, die sie unterrichteten.
Diese Situation entspricht genau dem Szenario, das die Kritiker der Bildungsgutscheine besonders fürchten: Sie gehen in einem solchen Fall davon aus, dass die Besten der Kinder bzw. die Kinder der noch am engagiertesten Eltern von den entsprechenden Schulen »abwandern«, während die schlechtesten bzw. vernachlässigsten Schüler zurück bleiben. Dies ist im öffentlichen Schulsystem ja ohnehin Gang und Gäbe: Engagierte ebenso wie karriereorientierte Eltern setzen alles daran, dass ihre Kinder zu ihrer Meinung nach »guten« Schulen gehen. Erst auf diese Weise entstehen ja überhaupt die so genannten »Brennpunkt«-Schulen.
Hoxby hat nun nicht die Schulen untersucht, zu denen Kinder hin »abwandern«, sondern diejenigen, die Auffangbecken für die zurückbleibenden Kinder bilden, deren Eltern keine aktive Wahl einer anderen Institution getroffen haben bzw. die von keiner anderen Institution aufgenommen worden sind.
Der Maßstab der Untersuchung waren die Ergebnisse von standardisierten Tests (die ähnlich funktionieren wie die Tests der Pisa-Studien). Dieser Rückgriff auf standardisierte Tests mit aller ihrer Problematik mag pädagogisch wenig einfallsreich erscheinen. Das entwertet jedoch die Ergebnisse von Hoxby nicht, sondern sollte Bildungsforscher dazu anregen, intelligentere und differenziertere Verfahren zu entwickeln. Immerhin legt Hoxby die durchschnittlichen Testergebnisse der ganzen Schule zugrunde und unterscheidet nicht zwischen »schlechten«, »mittleren« und »guten« Schülern, die nach der weiterhin gültigen pädagogischen Standardmeinung im Sinne einer »Normalverteilung« (25 : 50 : 25) vorkommen sollten. Damit ist die Ökonomin pädagogisch aufgeklärter als die meisten Pädagogen.
Ich gebe ausgewählte, repräsentative Zahlen aus dem umfangreichen Material der Hoxby-Studie wieder. (Tabelle1.)
Die im Test ermittelte durchschnittliche Leistungsstärke der Kinder in der Vergleichsgruppe ist deutlich höher als die der betroffenen Schulen. Dies ergibt sich zwangsläufig daraus, dass an dem Experiment ausdrücklich nur die Schulen beteiligt waren, die in sozialen Brennpunkten lagen. Interessant ist jedoch, dass die in das Experiment einbezogenen Schulen im Verlauf des Experiments die Leistungsstärke der Kinder deutlich erhöhen konnte und zwar mehr als die der Vergleichsgruppe. Bezüglich der Lesefähigkeit hat die Leistung in der Vergleichsgruppe sogar abgenommen, während sie in der Gruppe der betroffenen Schulen (leicht) zugenommen hat.
Damit dies nicht als Effekt von eventuell erhöhten Geldmitteln gedeutet werden kann, sehen wir uns die gleichen Tabelle dargestellt als »Produktivität« an. Unter Schulproduktivität versteht Hoxby die Testergebnisse bezogen auf die Ausgaben: Produktivität wird von ihr gemessen als Testpunkt pro tausend Dollar Ausgabe für jeden Schüler. Je größer die Verhältniszahl, um so größer ist die Produktivität. Auch hier könnte man sich ein feinsinnigeres Maß für die Schulproduktivität wünschen. Das von Hoxby entwickelte Maß ist jedoch, bis ein besseres vorgelegt wird, ein guter erster Ansatz, überhaupt die Produktivität von Schulen zu untersuchen. (Tabelle 2.)
Das Ergebnis von Tabelle 2 ist deckungsgleich mit dem aus der Tabelle 1: Die Vergleichsgruppe ist »produktiver« (die Schüler bringen einen bildungsfreundlicheren Hintergrund mit, sodass es einfacher und damit auch kostengünstiger ist, sie zu unterrichten), aber die in das Experiment einbezogenen Schulen holen deutlich auf. Bezüglich des Lesenlernens (das in den USA seit Jahrzehnten eine besondere schwierige Situation darstellt, wie aus George Dennisons Bericht ja auch deutlich hervorgeht) ist der Abfall der Produktivität anders als in der Vergleichsgruppe sehr gering. Verknüpfen wir Tabelle 2 mit Tabelle 1, so zeigt sich, dass die in das Gutscheinsystem einbezogenen Schulen durch den geringfügig erhöhten Einsatz von Geldmitteln die Lesefähigkeit ihrer Schüler steigern konnten, während in der Vergleichsgruppe trotz deutlich größerem Einsatz von Geldmitteln die getestete Lesefähigkeit sogar noch abgenommen hat.
Wie lässt sich das Ergebnis der Hoxby-Studie interpretieren? Die öffentlichen Schulen haben innerhalb dieses Experimentes die Wahl, entweder einer zunehmenden Abwanderung tatenlos zuzusehen, die letztendlich in der Schließung der Schule und Entlassung der Lehrer münden würde, oder aber aktiv zu werden und zu versuchen, Eltern und Schüler zu überzeugen, in dieser Schule zu bleiben. Während über Jahrzehnte hinweg die Lehrerfunktionäre in den USA (wie auch in Deutschland) davon gesprochen haben, ein Verbesserung der Bildung gerade der Unterprivilegierten sei nur mit mehr und noch mehr Geld zu erreichen, schafften es die Lehrer in den vom Gutscheinplan betroffenen Schulen innerhalb weniger Jahre, sensationelle Erfolge bei den unterprivilegierten, bildungsfeindlichen Schülern zu erreichen. Dafür geben sie nicht mehr, sondern eher weniger Geld aus.
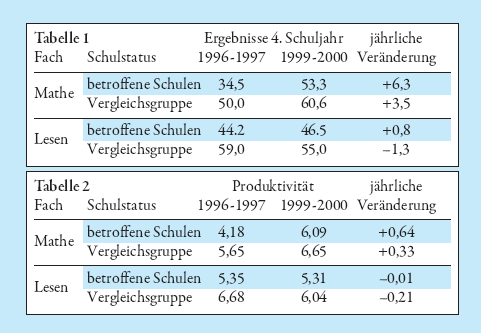
Die Funktionen der öffentlichen Schule
Das Gutscheinmodell von Milton Friedman würde es den experimentierfreudigen Lehrern, Eltern und Schülern erlauben, pädagogische Ideen und Innovationen auszuprobieren, ohne dass denjenigen Menschen, die am Hergebrachten festhalten möchten, irgendetwas aufgezwungen würde: Sie könnten einfach so weitermachen wie gewohnt. Sozial nachteilige Folgen sind nach den vorliegenden Erfahrungen nicht zu erwarten. Auch die Bildungsbudgets des Staates würden nicht größer werden müssen. Diese Ideen vertrete ich seit gut dreißig Jahren. (21) All die Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass Argumente für die Entstaatlichung von Schulen schlichtweg ignoriert werden. So konnte ich zum Beispiel wiederholt darauf hinweisen, dass ein steuerfinanziertes öffentliches Schulwesen keineswegs sozial gerecht sei, die nachfolgende Diskussion aber drehte sich stets darum, dass man sich aus sozialpolitischen Gründen keine Entstaatlichung der Schule denken könne. Das hätte ich verschmerzen können, wenn jemand sich die Mühe gemacht hätte, mein Argument zu widerlegen. Auf diese Mühe warte ich bis heute. Die soziale Funktion der Schule wird immer noch unhinterfragt vorausgesetzt, ohne dass es eines Beweises bedürfte. Vielmehr sind die wenigen bisherigen Versuche, den staatlichen Einfluss in bescheidenstem Ausmaße zurückzufahren, dahingehend ausgelegt worden, dass die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Lohmann mir zurufen zu müssen meinte, für eine anarchistische Kritik der Schule sei es zu spät, weil der Staat sich schon überall aus der Bildungsverantwortung heraus stehlen würde. (22)
Andererseits gibt es durchaus heftige Kritik an der Schule, besonders nach dem sog. Pisa-Schock. Die Schule würde nicht mehr tun, was man von ihr erwarte, nämlich eine für das Leben und besonders für den Beruf angemessene Grundlage bei den jungen Menschen zu schaffen. Doch diese Kritik mündet allenthalben in der Forderung nach einer Veränderung der öffentlichen Schule. In den folgenden Abschnitten möchte ich der Frage nachgehen, warum das so ist. Meine Frage lautet: Wie schafft es das abstrakte Prinzip der Staatsschule, sich unangreifbar zu machen, während gleichzeitig die konkrete Schulwirklichkeit so heftig attackiert wird? Es hat nämlich meiner Erfahrung nach gar keinen Zweck, eine noch so durchdachte Blaupause von Alternativen zur öffentlichen Schule vorzulegen, wenn die Bereitschaft, die Staatlichkeit der Schule als Prinzip ernsthaft in Erwägung zu ziehen, gar nicht vorhanden ist. Die Antwort auf die Frage nach dem Erfolg des Staatsschulprinzips besteht aus vier miteinander verzahnten Funktionen der Schule. Die Analyse jeder der Funktionen beziehe ich auf die aktuelle Bildungspolitik. Die vier Funktionen sind Bevormundung, Selektion und Regelung des Berufszugangs durch das Berechtigungswesen, Überwälzung von Kosten und Umverteilung.
Bevormundung. In einer Berliner Realschule wird Deutsch als Pflichtsprache auf dem Schulhof eingeführt. Ein Bundestagsvizepräsident, SPD, findet das gut. Die konservative Tageszeitung »Die Welt« applaudiert zu dieser Idee der Zwangsintegration. (23) Die Koordinatorin für Sprachförderung des Berliner Senats schreibt dazu in der Welt, die Schule sei der einzige Ort, wo viele Kinder Deutsch lernten. Nur ein paar verstreute linke und grüne Politiker sowie einige Vertreter ausländischer Volksgruppen kritisieren die Entscheidung der betreffenden Realschule und sehen in »Deutsch als Pflichtsprache auf dem Schulhof« kein geeignetes Modell. (24)
Vom freiheitlichen Standpunkt aus könnte man fragen: Warum nicht den Schulen freistellen, wie sie das wirkliche oder vermeintliche Sprachproblem lösen wollen? Warum nicht dann, wenn es alternative Angebote gibt, Eltern oder sogar die Schüler selbst entscheiden lassen, welches das bessere Modell für sie ist? Der freiheitliche Standpunkt ist scheinbar nicht sehr attraktiv, denn er wird von kaum jemandem vorgebracht, auch und insbesondere von den konservativen Bildungsexperten nicht, die so gern vom Elternrecht reden, wenn es darum geht, das Einheitsschulsystem in der besonderen Form der Dreigliedrigkeit zu verteidigen.
Um herauszufinden, warum der freiheitliche Standpunkt als so wenig attraktiv erscheint, analysiere ich die erwähnte Aussage der Koordinatorin für Sprachförderung in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: »Die Schule ist der einzige Ort, wo viele Kinder Deutsch lernen.«
Genauer betrachtet, ist der Satz dreist. Die Muttersprache wird zunächst im Elternhaus und dann unter Gleichaltrigen gelernt. Kinder, die in einer Umgebung leben, in der die Muttersprache nicht gesprochen wird, lernen von den Gleichaltrigen die Fremdsprache. Im Alter von ungefähr 3 bis 12 Jahren brauchen sie dazu, wenn sie denn Interesse haben, wenige Wochen. … wenn sie denn Interesse haben … Der Satz der Berliner Koordinatorin für Sprachförderung deutet in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein solches Interesse offenbar nicht vorliegt. Darum soll die Schule eingreifen. Es geht, kurz gesagt, um Bevormundung. Diese Bevormundungsabsicht wird aber nicht als solche bezeichnet, sondern verkleidet sich als »eigentliches« Interesse der Kinder, die dieses allerdings scheinbar nicht erkennen. Der Satz müsste also lauten: »Die Schule ist der einzige Ort, an welchem wir die Kinder zu ihrem eigenen Besten dazu zwingen können, Deutsch zu lernen, wenn sie nicht – wie es natürlich wäre – es von sich aus tun.« Zu diesem Thema findet sich viel Material auch in dem vorliegenden Buch von George Dennison.
Der Bevormundungsaspekt macht die öffentliche Schule so attraktiv: Man meint, mit Hilfe der Schule dasjenige Gesellschaftsmodell durchsetzen zu können, das man für richtig hält. Nicht, weil die Schule versagen würde, dieses Ziel zu erreichen, wird an ihr so verbissen festgehalten, sondern weil sie so effektiv bei der Bevormundung ist. Allerdings soll diese Effektivität noch weiter gesteigert werden, indem letzte Zufluchtsstätten autonomen kindlichen Handelns und Lernens angegriffen werden. (25) Die Forderung, auf dem Schulhof deutsch zu reden, könnte offensichtlich nur dadurch umgesetzt werden, dass die Gespräche der Kinder bis in die privatesten Bereiche hinein überwacht oder dass ausgedehnte Systeme von Denunziantentum installiert werden.
Wenn es gegen den Bevormundungsaspekt der Schule so wenig Widerstand von den betroffenen Eltern und Schülern gibt, so darum, weil sie akzeptieren, dass die Unterdrückung letztlich zu »ihrem Besten« geschieht. Die Schule vertritt die Interessen der Kinder in Hinsicht ihrer Zukunfts- und Berufsaussichten. Niemand mehr hat heutzutage eine Chance im Leben, es sei denn durch eine gelungene Schuldbildung. Bezogen auf die Güte und Zukunftsfähigkeit der Schulbildung gibt es allerdings weitverbreitete Kritik. Schauen wir uns die Kritik an der mangelnden berufsqualifizierenden Qualität der Schulbildung als nächstes etwas genauer an und fragen uns, warum nicht wenigstens diese Kritik zu Veränderung oder zur Entwicklungen von Alternativen führt.
Selektion und Kostenüberwälzung. Grundlage meiner Analyse ist die Bemerkung des Ausbildungsverantwortlichen einer Bank. In der Presse wurde er mit der resignativen Bemerkung zitiert, von 100 Bewerbungen seien 80 Prozent schlichtweg unbrauchbar, weil schon das Anschreiben orthografische Fehler enthalte. (26) Die Bewerber seien nebenbei bemerkt Abiturienten. Sagt das nicht alles über das Ungenügen der Schule? »Pisa« lässt also grüßen. Genauer betrachtet offenbart die Bemerkung des Ausbildungsverantwortlichen ganz andere Dimensionen der Debatte. Ich stelle zwei Fragen, die schnell zeigen, dass es sich bei der Klage um das Versagen der Schule um nichts als Heuchelei und Krokodilstränen handelt.
Die erste Frage lautet: Um wie viele Ausbildungsstellen hat es sich gehandelt? Das Faktum: Um zehn.
Also: Auch wenn alle Bewerber ein korrektes Anschreiben abgeschickt hätten, wären eben nicht mehr als zehn von ihnen genommen worden. Die 80 Bewerber, die aufgrund orthografischer Fehlerhaftigkeit ihres Anschreibens abgewiesen wurden, hätten selbst mit einer besseren Schulbildung keinen Ausbildungsplatz von der Bank bekommen. Der Ausbildungsverantwortliche hat 20 Bewerber in die engere Wahl gezogen und von ihnen dann zehn ausgewählt. Wenn nun alle 100 Bewerber eine in seinen Augen bessere Schulbildung gehabt hätten, hätte der Ausbildungsbeauftragte schlicht ein anderes Kriterium als das der orthografischen Richtigkeit der Anschreiben anlegen müssen, um eine Vorauswahl zu treffen, es sei denn, er wäre bereit, fünf mal mehr Bewerber unter die Lupe zu nehmen. Sogar wenn er dazu bereit gewesen wäre, hätten am Schluss nicht mehr als eben genau die vorgesehenen zehn Bewerber einen Ausbildungsvertrag bekommen.
Die Aussage, mit besserer Schulbildung habe man mehr Chancen, bleibt für jeden Bewerber in der individuellen Perspektive richtig. Aus ihr darf allerdings gerade nicht abgeleitet werden, dass es weniger Jugendliche ohne Ausbildungsplatz oder weniger Arbeitslose gäbe, wenn bloß die Schulbildung der Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitslosen besser wäre. Genau diese Einsicht drückt sich auch in den Forderungen nach schärferer Auslese und Leistungsorientierung in den Schulen aus: Wenn weniger Schüler Abitur machen würden, hätte der besagte Ausbildungsbeauftragte der Bank anstatt 100 Bewerber vielleicht nur die 20 gehabt, die keine orthografischen Fehler gemacht haben. Die 80 anderen Jugendlichen hätten dadurch jedoch keine höheren Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Dagegen hätte unser Ausbildungsbeauftragter weniger Arbeit. Die Schule soll selektieren, damit stets genau so viele qualifizierte Bewerber zur Verfügung stehen, wie gebraucht werden. (27) Das ist Planwirtschaft im Bereich des Humankapitals.
Nun zu der zweiten Frage: Was würde unser Ausbildungsbeauftragter tun, wenn er 30 Stellen zu besetzen gehabt hätte? Es standen ihm ja nur 20 zur Verfügung, die über seiner Meinung nach ausreichende orthografische Fähigkeiten verfügten. Hätte er die 10 verbleibenden Stellen nicht besetzt? Nein, jedenfalls nicht, wenn sie für das Unternehmen wirklich nötig sind.
Die Antwort auf die Frage, was unser Ausbildungsbeauftragter tun würde, wenn er 30 Stellen zu besetzen gehabt hätte, erfordert ein bisschen Fantasie und Wühlen in der Geschichte. Wir suchen Zeiten, in denen Vollbeschäftigung und Arbeitskräfteknappheit geherrscht hatten. Eine erste Möglichkeit für unseren Ausbildungsverantwortlichen wäre es, die verschiedenen Arbeitsplätze daraufhin zu untersuchen, an welchen orthografische Fähigkeiten unverzichtbar und an welchen sie nicht so wichtig sind. Diese erste Möglichkeit verweist auf die Einsicht, dass die Auswahlkriterien der Stellenbesetzung nicht objektiv gegeben sind, sondern zumindest in gewissem Ausmaße den Umständen angepasst werden können. Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, die Bewerber daraufhin anzuschauen, bei welchen es aussichtsreich sein könnte, ihnen durch Weiterbildung die fehlenden Fähigkeiten zu vermitteln. Diese zweite Möglichkeit ist in doppelter Weise erhellend: Zum einen zeigt sich hier wieder, dass es den angesprochenen planwirtschaftlichen Anspruch gibt, in der Schule so viele geeignete Bewerber zu produzieren, wie gebraucht werden; zum anderen dass die steuerfinanzierte Bildung eine Überwälzung von Kosten auf die Allgemeinheit darstellt.
Anstatt darüber zu jammern, dass die Schule nicht in der gewünschten Weise für das Berufsleben qualifizieren würde, könnten die Eltern, Arbeitgeber und Jugendlichen selbst eigenfinanzierte Alternativen suchen oder, wenn es sie noch nicht gibt, aufbauen. Aber es ist ja viel praktischer, auf Kosten der Allgemeinheit so viel Qualifikation wie möglich erlangen zu wollen und dann nur den übrig bleibenden Rest mit eigenen Geldmitteln zu finanzieren.
Selbstredend stehen die eigenfinanzierten Alternativen zur Schule unter der ökonomischen Restriktion des Friedman-Theorems (28) – sie müssen nämlich gegen die scheinkostenlosen öffentlichen Angebote konkurrieren. Am Rande bemerkt: Dieses Theorem trifft nur dann zu, wenn die Qualifikationsleistung des scheinkostenlosen öffentlichen Angebotes mehr als Null beträgt, also nicht völlig versagt. Vor allem aber erklärt das Friedman-Theorem nicht, warum es keine öffentliche Diskussion über Entstaatlichung gibt. Denn wenn die steuerfinanzierte öffentliche Schule sowohl teuer als auch nicht in der Lage ist, angemessen zu qualifizieren, wäre doch die logisch einleuchtende Antwort die der Entstaatlichung. Die Forderung nach Entstaatlichung wird jedoch nicht gestellt, weil die Kräfte, die die politische Diskussion beherrschen, zumindest subjektiv meinen, von der Steuerfinanzierung zu profitieren.
Berechtigungswesen. Ein weiteres Element, das die öffentliche Schule zum unangefochtenen Erfolgsmodell macht, ist in dem obigen, auf Überlegungen von Paul Goodman basierenden Hinweis enthalten, es gäbe keinen anderen Zugang zu beruflichen Chancen als die Schulbildung. Es ist üblich, dies als »natürliche« Gegebenheit der industriellen Entwicklung zu kennzeichnen. Inwiefern dies nicht die einzige Interpretationsmöglichkeit darstellt, möchte ich an der Aussage eines anderen Ausbildungsbeauftragten deutlich machen. Sie steht allerdings dem Mainstream der Überzeugungen entgegen. Es handelt sich um eine persönliche Mitteilung aus dem Bereich der Maschinenbaubranche. Vor noch nicht allzu langer Zeit konnte man mit Hauptschulabschluss Maschinenbauer werden. Heute ist Abitur notwendig. Allerdings könnten die betrieblichen Arbeiten laut diesem Ausbildungsbeauftragten immer noch auch Hauptschüler übernehmen. Das Problem besteht darin, dass sie die Berufsschule nicht schaffen würden. Darum werden Abiturienten genommen. Während jedoch Maschinenbauer für Hauptschüler ein attraktiver Beruf darstellt und sich dementsprechend früher die besten Hauptschüler beworben haben, erscheint es Abiturienten weniger erstrebenswert, diesen Beruf zu ergreifen, und dementsprechend bewerben sich die schlechtesten, also anderswo chancenlosen Abiturienten. Hauptschüler allerdings haben keine Chance mehr, sodass jeder, der Maschinenbauer werden will, das Abitur anstreben muss. Auf diese Weise schafft die Ausbildungsordnung die Nachfrage nach Schulbildung ganz unabhängig von sachlicher Notwendigkeit. Ins Allgemeine übertragen nennen wir dies das »Berechtigungswesen«. Das Berechtigungswesen ist das machtvolle Instrument, mit dem sich die Schule unabdingbar macht und zwar immer diejenige Schulform, die die angestrebte Berechtigung zu verleihen in der Lage ist. Dann sieht es so aus, als sei die Schule »notwendig«. Sie ist es auch vom individuellen Standpunkt aus betrachtet, muss es aber vom gesellschaftlich-wirtschaftlichen Standpunkt her nicht sein. Nehmen wir den vorhin behandelten Aspekt von Knappheit des Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzangebotes hinzu, ergibt sich eine Spirale, in der immer mehr Schule als notwendig erscheint: Da die vorhandenen Arbeits- und Ausbildungsplätze von den jeweils schulisch am höchsten Qualifizierten eingenommen werden, müssen alle, die eine Chance haben wollen, nach der höchstmöglichen schulischen Qualifikation streben. Da diese überdies noch scheinkostenlos angeboten wird, gibt es kaum eine Grenze für die Ausdehnung der Nachfrage nach schulischen Qualifikationen.
Aus dem Berechtigungswesen ergibt sich zusammen mit der Scheinkostenlosigkeit eine stark egalisierende Tendenz. Da die Schule jedoch ebenso eine selektive Funktion hat, wie ich vorhin gezeigt habe, muss sich der Leistungsdruck auf die Schüler unausweichlich erhöhen. Widerspricht dieses Ergebnis meiner Analyse aber nicht der angesprochenen verbreiteten Klage über die Schlechtigkeit der Schüler bzw. das Versagen der Schulen? Keineswegs. Denn aufgrund der beschriebenen Spirale der Höherqualifizierung sind die Ansprüche enorm gestiegen. Vergleicht man heutige Abiturarbeiten mit denen von vor 20, 30 oder gar 50 Jahren, so stellt sich heraus, dass kaum einer der früheren Absolventen heute auch nur die geringste Chance hätte, selbst wenn die Orthografie früher regelgerechter gewesen sein mag (doch selbst das ist fraglich). (29) Sogar schärfer tritt dies bei akademischen Arbeiten hervor. Noch in den 1970er Jahren wurden Dissertationen akzeptiert, die heute kaum als Seminararbeiten durchgehen würden. (30)
Sozialpolitik und Chancengleichheit. Wie angekündigt bleibt ein viertes Element, das die Staatsschule unangreifbar zu machen scheint, zur Analyse übrig. Es ist das in der Erziehungswissenschaft wichtigste, in der öffentlichen Diskussion jedoch gegenüber der Qualifikation zurückgetreten. Es hängt mit der schon erwähnten Steuerfinanzierung der Staatsschule zusammen und handelt von der Chancengleichheit. Die öffentliche Schule würde es, so wird argumentiert, Kindern von weniger finanzstarken Schichten ermöglichen, die ihnen angemessene Schulbildung zu erhalten, auch wenn ihre Eltern sich das eventuell nicht würden leisten können. Insofern ist dieses Argument nur das sozialdemokratische Gegenstück des schon erwähnten Wunsches der Unternehmen, die Ausbildungskosten auf die Allgemeinheit zu überwälzen. Hier nun sollen die Kosten für die Kinder von weniger verdienenden Eltern auf die Allgemeinheit überwälzt werden. Allerdings ist das Argument nur unter zwei Voraussetzungen wirklich stichhaltig, nämlich
1. Schulausbildung ist für Berufschancen notwendig. Ich habe gezeigt, dass dies kein objektives Erfordernis, sondern ein Ausfluss des Berechtigungswesens ist.
2. Die Ausbildungskosten sind bereits von den Unternehmen auf die Allgemeinheit überwälzt worden.
Darüber hinaus vermag das sozialpolitische Argument allein noch gar nichts gegen die Entstaatlichung auszurichten. Denn es ist leicht vorstellbar, dass Privatschulen ihre Angebote machen und die Familien, die sich die Angebote nicht leisten könnten, die entsprechende Unterstützung erhalten. Ich erwähne dies nicht, weil ich ein solches System der Umverteilung durch Bildungsgutscheine für erstrebenswert halte, sondern weil es zeigt, dass ohne Hinzunahme eines weiteren Aspektes das sozialpolitische Argument gegen die Entstaatlichung stumpf bleibt. Der Aspekt, der hinzu kommt, schließt den Kreis zum Anfang: Weniger verdienende Eltern, so wird von Erziehungswissenschaftlern und Sozialpolitikern gesagt, würden schlechte Entscheidungen hinsichtlich der Schulbildung ihrer Kinder treffen. Die öffentliche Schule sei notwendig, um diesen Eltern gerade keine Entscheidungsfreiheit zu lassen. Damit wiederum sind wir bei der Bevormundungsfunktion der Schule.
Der falsche Schein von Entstaatlichung
Obwohl eine Entstaatlichung des Schulwesens in der Diskussion weitgehend tabuisiert ist, erfreuen sich Versatzstücke der Schulkritik großer Beliebtheit bei Bildungspolitikern (bei den Erziehungswissenschaftlern allerdings nicht mehr). Öffentliche Schulen, so ist zu hören, sollten »professionell gemanagt werden wie Unternehmen«. (31) Die Realität allerdings sieht anders aus: Selbst Autoren, die wie Ingrid Lohmann den »Rückzug« des Staates aus dem Schulwesen bekämpfen, legen Zahlen vor, die das Gegenteil belegen. (32) Was es mit dieser Merkwürdigkeit auf sich hat, zeigt exemplarisch die Einlassung des saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller (CDU), der »weniger Staat« und »bewährte betriebswirtschaftliche Methoden« im Schulwesen fordert und dann feststellt, dem »Abbau bürokratischer Bevormundung« und dem »Verzicht auf staatliche Feinsteuerung«, werde »im schulischen Bereich am besten durch das gegliederte Schulsystem entsprochen«. (33) Diese Aussage kann schwerlich ernst genommen werden, denn das »gegliederte Schulsystem« ist ja bekanntlich nicht in einem Prozess freiwilliger Vergesellschaftung entstanden, sondern durch »staatliche Feinsteuerung«. Im Folgenden will ich zeigen, dass sowohl die konservativ-liberalen Befürworter als auch die sozialdemokratischen Gegner der Einführung der Marktbedingung für das Schulwesen kein geeignetes Verständnis des Prozesses freiwilliger Vergesellschaftung haben.
Es geht in dieser Diskussion nämlich um ein neues Modell der staatlichen Steuerung des Schulwesens. Als dieses neue Steuerungsmodell werden die angeblich effizienten »Managementmethoden« der »Betriebswirtschaft« herbeizitiert. Sie sollen in die bestehenden staatlichen Schulen eingeführt werden, um diese leistungsfähiger zu machen. Dabei setzt man stillschweigend voraus, dass es tatsächlich die lehrbuchhaft vorliegenden »Managementmethoden« seien, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Dagegen steht folgende Beobachtung: Die Methoden, um Unternehmen zu managen, werden im betrieblichen Alltag häufig missachtet, führen zu vielfältigen Widersprüchen und enden nicht selten im Chaos, sodass man sich wundert, wie es überhaupt gelingen kann, gleichwohl halbwegs brauchbare Resultate zu erzielen.
Auch in Unternehmen gibt es Fehlentscheidungen. Keine bekannte Managementmethode schützt vor solchen, denn andernfalls würden Unternehmen nie in Schwierigkeiten geraten. Wie schaffen es die meisten Unternehmen, ihren jeweiligen Fehlentscheidungen gegenzusteuern? Nur Gegensteuerung ermöglicht, letztendlich doch noch erfolgreich zu sein, sodass die Ergebnisse des Marktprozesses aufs Ganze gesehen effizienter sind als alle Versuche mit der Staatswirtschaft. Die Managementmethoden führen nicht losgelöst vom Marktprozess zur Effizienz. (34)
Effizienz ist also nicht Kennzeichen von Unternehmen an sich, sondern sie wird erst durch den Marktprozess hergestellt: Die Entscheidungsträger in den Unternehmen müssen dann gegensteuern, wenn der Profit gefährdet ist. In den betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern wird die formelle Art beschrieben, wie bei drohenden Verlusten das Management sein Unternehmen umstrukturiert, die Mitarbeiter und Führungskräfte weiterbildet und trainiert, die Herstellung effizienter macht, die Produkte überarbeitet oder das Marketing verbessert. Sehr viel weniger reflektiert ist in der Betriebswirtschaft die zweite, die informelle Form des Gegensteuerns. (35) Denn es können die Umstrukturierungen selbst sein, die die einschneidendsten Probleme verursachen. Wie in jeder Kommandowirtschaft sind auch in großen Firmen etliche Entscheidungen des Managements unrealistisch, widersinnig oder kontraproduktiv, oder sie basieren auf Daten, die auf ihrem Weg durch die Hierarchie nach oben verzerrt worden sind. In diesem Falle greift die informelle Form der Gegensteuerung, bei der Mitarbeiter und Zwischenvorgesetzte unsinnige Regelungen und Anordnungen unterlaufen. Ohne die informelle Form der Gegensteuerung – also ohne Regelverletzungen – könnte wohl kaum ein Unternehmen bestehen, denn die betriebswirtschaftlichen Managementmethoden verhalten sich zum Alltag in den Betrieben wie die Didaktiken zur Schulwirklichkeit.
Beide Formen der Gegensteuerung, die formelle wie die informelle, sehen sich Widerständen und Risiken bei ihrer Durchsetzung gegenüber: Formelle Gegensteuerungen wie etwa Restrukturierungen des Unternehmens greifen in eingespielte Abläufe ein und stellen angestammte »Besitztümer« von Führungskräften und Mitarbeitern in Frage. Informelle Gegensteuerungen bergen für die Mitarbeiter, die die vorgeschriebenen Abläufe missachten, Gefahr in sich, dass sie dafür sanktioniert werden – besonders dann, wenn die Regelverletzung nicht den gewünschten Erfolg hatte. Im Unternehmen werden die Widerstände überwunden und die Risiken in Kauf genommen, weil ein untätiges Verharren zum Bankrott führen müsste und damit den Verlust des Arbeitsplatzes auch für den nach sich ziehen würde, der sehenden Auges ein entscheidendes Problem nicht anpackt. Gleichwohl berichten Mitarbeiter mitunter davon, dass es zu Fehlentwicklungen in ihrem Unternehmen kommt und dass notwendige Veränderungen langsam vor sich gehen, sei es durch formelle, sei es durch informelle Maßnahmen. Die Bedingung des Marktes ist derart in zweierlei Hinsicht entscheidend für die Existenz des effizienten Unternehmens: Der fehlende Erfolg zwingt zur Gegensteuerung und der drohende Arbeitsplatzverlust verleiht den Mut, die auftretenden Widerstände gegen Veränderungen zu beseitigen und Risiken bei ihrer Durchsetzung einzugehen. Was geschieht jedoch, wenn eine Organisation durch Managementmethoden restrukturiert wird, ohne dass sie der Marktbedingung unterliegt?
Es ist nicht schwer, sich auszumalen, dass eine solche Restrukturierung zunächst viel hartnäckigeren Widerstand hervorruft: Eine Fortschreibung des Missstandes, der mit der Restrukturierung beseitigt werden soll, bringt keinen Bankrott und damit keinen Arbeitsplatzverlust mit sich. Deshalb finden die Versuche, den Besitzstand zu wahren, kaum eine Grenze: Die Besitzstandwahrung hat keine unerwünschten ökonomischen Konsequenzen für den Besitzstandwahrer selbst. Ist eine Restrukturierung aufgrund von äußerem politischen Druck hin gleichwohl vollzogen worden, gibt es in der nicht der Marktbedingung unterliegenden Organisation viel weniger Anreiz, mit informeller Gegensteuerung eventuell unsinnigen Auswirkungen zu begegnen. Denn eine informelle Gegensteuerung ist nicht nur mit Anstrengungen verbunden, sondern auch mit der Gefahr von Disziplinierung. Arbeitsplatzverlust droht einem Beamten oder einem Angestellten des staatlichen Sektors normalerweise nur, wenn er gegen Vorschriften verstößt. Bürokratische Aufwendungen, die in Unternehmen des privaten Sektors im Gefolge von ISO-Zertifizierung und »Total Quality Management« die Produktion zu hemmen drohten, sind durch informelle Gegensteuerungen, also gezielte Regelverletzungen, in den Unternehmen neutralisiert worden. Im Kontext einer Organisation, die ihren Erfolg nicht im Marktprozess bewähren muss, kann eine derartige Restrukturierung den Betrieb völlig lähmen. Es ist demnach zu vermuten, dass eine Einführung von Managementmethoden in der Schule die versprochenen positiven Wirkungen nicht zeitigen kann, wenn die Schule im Kontext der staatlichen Kommandowirtschaft verbleibt.
Warum unterzieht sich eine Organisation überhaupt einer Restrukturierung? Für Unternehmen habe ich den Grund bereits genannt: Es unterzieht sich ihr, weil es dem fehlbaren Urteil der Handelnden nach auf diese Weise besser im Marktprozess bestehen kann. Bestand im Marktprozess setzt voraus, dass das Unternehmen Produkte für seine Kunden zur Verfügung stellt, die die Kunden in der Relation von Preis zu Leistung überzeugen. Außerdem muss das Unternehmen diese Produkte so effizient herstellen, dass bei dem Preis, den die Kunden zu zahlen bereit sind, (36) noch Profit übrig bleibt.
Bei einer durch Steuern finanzierten Organisation (37) wie der öffentlichen Schule vermittelt sich der Druck der Veränderung auf andere Weise. Es sind vor allem Legitimationsprobleme, die von außen zur Veränderung drängen. Das neueste Legitimationsproblem hat sich für die öffentliche Schule aus der Diskussion um das schlechte Abschneiden Deutschlands in der Pisa-Studie ergeben. Ein weiterer heute immer wichtiger werdender Grund für den Ruf nach Veränderung im öffentlichen Schulwesen sind die leeren Staatskassen. Während sich also Veränderungsbedarf im Unternehmen aus der Beziehung zwischen Produkt, Kunde und Herstellung ergibt, verhält es sich bei der steuerfinanzierten Organisation anders: Nicht die Nutzer – im Falle der Schule sind das Kinder, Jugendliche und Eltern – definieren das Produkt, sondern die politische Öffentlichkeit. Ebenso bezahlen die Nutzer das Produkt nicht direkt, sondern die Steuerzahler insgesamt. Unter dem Gesichtspunkt freiwilliger Vergesellschaftung sind nicht Kinder, Jugendliche und Eltern die Kunden der Schule, sondern die finanziellen Instanzen, von denen die Schule erhalten wird, sowie die politischen Instanzen, die der Schule die Strukturen geben und die Inhalte vorschreiben.
Ein Unternehmen gerät im Marktprozess durch die Summe der Einzelentscheidungen der Kunden in Schwierigkeiten. Eine steuerfinanzierte Organisation gerät dagegen durch politische Entscheidungen der sie konstituierenden Instanzen in Schwierigkeiten.
Es ist wichtig, diesen Unterschied deutlich herauszuarbeiten, weil ein wesentliches Kennzeichen der Diskussion um die Schule die Widersprüchlichkeit der Forderungen ist, die an sie gestellt werden. Die Schule soll Begabte fördern und ebenso Chancengleichheit garantieren, sie soll Leistungsbereitschaft hervorrufen und ebenso das Eigenrecht der Kindheit beachten, sie soll für den Konkurrenzkampf fit machen und ebenso soziales Lernen ermöglichen, sie soll die Allgemeinbildung stärken und ebenso auf die spezialisierten Bedürfnisse der Informationsgesellschaft eingehen, sie soll die gemeinsamen Werte der Gesellschaft vermitteln, ohne dabei jedoch irgendeine relevante soziale Gruppe zu verärgern, und ebenso zur Kritikbereitschaft erziehen, sie soll in Übereinstimmung mit den Eltern handeln und ebenso die Fehler der häuslichen Sozialisation korrigieren – um nur einige der offensichtlichsten Widersprüche aufzuzählen. Und natürlich soll sie mehr erreichen, jedoch weniger kosten.
Ein Unternehmen reagiert auf widersprüchliche Anforderungen der Kunden mit einer Differenzierung des Angebots. Oft kann ein Unternehmen allerdings nicht einmal durch verschiedene Produkte alle sich widersprechenden Kundenanforderungen erfüllen, sondern es bedarf mehrerer Unternehmen mit eigenen Profilen nebeneinander. Es stellt für die Kunden des einen Angebotes kein Problem dar, wenn es auch noch andere Angebote gibt, weil sie jeweils nur das Produkt bezahlen, das sie selbst nutzen möchten. Wer einen VW Golf kauft, hat nicht das Bedürfnis, auf das Aussehen oder die Motorleistung des Ford Focus Einfluss zu nehmen. Dies ist bei der Schule bzw. allen steuerfinanzierten Organisationen anders: Da alle die Leistung durch die Steuern schon bezahlt haben, können sie berechtigter Weise erwarten, dass auch ihr Bedürfnis angemessen berücksichtigt wird. Daraus ergeben sich Legitimationsprobleme und Widersprüchlichkeiten, die typisch für so genannte öffentliche Güter sind.
Andererseits lassen sich die Kunden öffentlicher Güter eine sehr weitgehende Widersprüchlichkeit in den zur Verfügung gestellten Produkten gefallen. Dies hängt mit der Abkoppelung von Bezahlung und Inanspruchnahme der Leistung zusammen. Wenn der Staat jedem Bürger, der einen Führerschein besitzt, einen aus Steuermitteln bezahlten VW Golf zur Verfügung stellen würde, (38) würden wahrscheinlich auch viele der heutigen Käufer des Ford Focus dieses Angebot annehmen, anstatt sich ein Auto zu kaufen, das sie bezahlen müssten. In Wahrheit würden sie ja dann zwei Autos bezahlen, nämlich indirekt mit ihren Steuern den VW Golf und direkt ihr Wunschauto. Im Gegenzug würden jedoch, demokratische Strukturen vorausgesetzt, alle Steuerzahler den Anspruch erheben, über das eine, vom Staat angebotene Auto mitzubestimmen.
Das Produkt, das ein Unternehmen auf dem Markt anbietet, wird keine Kennzeichen enthalten, die die potenziellen Kunden nicht hinnehmen wollen. Das scheint ein solcher Allgemeinplatz zu sein, dass es banal klingt, ihn auszusprechen. Doch im Vergleich zum Angebot öffentlicher Güter ist es entscheidend, sich an diesen scheinbaren Allgemeinplatz zu erinnern. Denn bestimmte Anforderungen an die Schule sollen geradezu gegen den Willen einzelner Betroffener durchgesetzt werden. Das eindeutigste Beispiel ist die allgemeine Schulpflicht. (39) Ein anderes Beispiel sind etwa Integrationsprogramme, die den Widerstand von Eltern hervorrufen. Ein besonders wichtiges Beispiel stellt die Selektionsfunktion der Schule dar, weil sich wohl niemand freiwillig aussortieren lassen wollte.
Wenn es um die Frage geht, welche Ziele die Einführung nicht-staatlicher Strukturen in das Schulwesen erreichen kann, muss also die Form dieser Ziele genau betrachtet werden. Ziele, die in sich widersprüchlich sind, können ebenso wenig unter der Bedingung freiwilliger Vergesellschaftung umgesetzt werden wie Ziele, die keine Zustimmung der Betroffenen haben. Aber genau diese beiden Zielformen, die widersprüchliche und die nicht zustimmungsfähige Form, herrschen in der Diskussion um das öffentliche Schulwesen vor. Darin liegt der Grund, warum zwar mit betriebswirtschaftlichen Elementen die Effizienz der Schule gesteigert werden soll, ohne aber die Bedingung freiwilliger Vergesellschaftung für sie herzustellen. Allerdings ist »Effizienz« keine unabhängige Größe. Sie kann nur im Zusammenhang mit der Zieldefinition ermittelt werden.
Anmerkungen
01 Vgl. z.B.: Petzold, Hilarion/Brown, George I. (Hg.), Gestaltpädagogik, München 1977; Prengel, Annedore (Hg.), Gestaltpädagogik, Weinheim 1983; Burow, Olaf-Axel, Gestaltpädagogik und Erwachsenenbildung, in: Fuhr u.a. (Hg.), Handbuch der Gestalttherapie, Göttingen 2001.
02 Vgl. z.B.: Blankertz, Stefan, Legitimität und Praxis: Die öffentliche Erziehung als pädagogisches, soziales und ethisches Problem, Studien zur Relevanz und Systematik angelsächsischer Schulkritik, Wetzlar 1989.
03 Blankertz, Stefan/Doubrawa, Erhard, Lexikon der Gestalttherapie, Wuppertal 2005.
04 Von Humboldt, Wilhelm, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792), in: ders., Werke I, Stuttgart 1980, S. 64.
05 Vgl. z.B. Paul Goodman, Das Verhängnis der Schule (Compulsory Mis-education, 1964), Frankfurt/M. 1975. Nachwort von Stefan Blankertz.
06 Vgl. z.B. Erving und Miriam Polster, Gestalttherapie (1975), Wuppertal 2003, S. 297f.
07 Vgl. z.B. aus der Flut von kritischen Auseinandersetzungen mit dem deutschen öffentlichen Schulsystem: Bernd Fahrholz, Sigmar Gabriel und Peter Müller (Hg.), Nach dem Pisa-Schock, Hamburg 2002. Konrad Adam, Die deutsche Bildungsmisere: Pisa und die Folgen, Berlin 2002. Kurt Singer, Die Würde des Schülers ist antastbar, Reinbek 2002. Lotte Kühn, Das Lehrerhasserbuch: Eine Mutter rechnet ab, München 2005.
08 Vgl. Hartmut von Hentig, Wie frei sind freie Schulen? Gutachten für ein Verwaltungsgericht, Stuttgart 1985.
09 Vgl. z.B. Achim Leschinsky und Peter Martin Roeder, Schule im historischen Prozess, Stuttgart 1976. Dietrich Goldschmidt und Peter M. Roeder (Hg.), Alternative Schulen: Gestalt und Funktion nichtstaatlicher Schulen im Rahmen öffentlicher Bildungssysteme, Stuttgart 1979. Theodor Ballauff, Funktionen der Schule, Weinheim 1982. Hartmut von Hentig, Wie frei sind freie Schulen? Gutachten für ein Verwaltungsgericht, Stuttgart 1985. Jürgen Diederich und Heinz-Elmar Tenorth, Theorie der Schule: Ein Studienbuch zu Geschichte, Funktionen und Gestaltung, Berlin 1997. Frank-Olaf Radtke und Manfred Weiß (Hg.), Schulautonomie, Wohlfahrtsstaat und Chancengleichheit, Opladen 2000.
10 Milton Friedman, Die Rolle des Staates im Erziehungswesen (1955), in: ders., Kapitalismus und Freiheit (1962), Frankfurt/M. 2002. Da das Gutschein-System eine Verteilungsbürokratie voraussetzt, ziehe ich die Variante vor, Eltern, die ihre Kinder nicht zur öffentlichen Schule schicken, einen um die Kosten des jeweilig unbeansprucht bleibenden Platzes verringerten Steuersatz zu berechnen (und Eltern, die weniger bzw. keine Steuern zahlen, die etwaige Differenz auszubezahlen). Solche Feinheiten der Umsetzung spielen jedoch für die folgende Diskussion keine Rolle. Zur Übersicht und ausführlichen ökonomischen Diskussion der Varianten alternativer Bildungsfinanzierung vgl. Ulrich van Lith, Der Markt als Ordnungsprinzip des Bildungsbereichs, München 1985.
11 Christopher Jenks hatte 1972 in seinem aufsehen erregenden Report »Inequality« (dt. Chancenungleichhheit, Reinbek 1973) die empirisch untermauerte These aufgestellt, die Ungleichheit in der Gesellschaft sei mit Schulpolitik nicht überwindbar. Er engagierte sich als Sozialist in den von der konservativen Nixon-Regierung unterstützten ersten Experimenten mit Bildungsgutscheinen.
12 McEwan, Patrick, und Martin Carnoy, The Effectiveness and Efficiency of Private Schools in Chile’s Voucher System, in: Educational Evaluation and Policy Analysis, 2000 (22/3). Hoxby, Caroline, Do Private Schools Provide Competition for Public Schools?, National Bureau of Economic Research 1994. Contreras, Dante, Vouchers, School Choice and the Access to Higher Education, Universidad de Chile 2002.
13 Vgl. z.B. Vegas, Emiliana, School Choice, Student Performance, and Teacher and School Characteristics: The Chilean Case, World Bank 2002. Im Ländervergleich der Pisa-Studie liegt Chile in der Spitzengruppe von Lateinamerika (das ist international jedoch recht niedrig) gleich mit Kuba. Auch in sonstiger Hinsicht zeigt sich in den Pisa-Vergleichen, dass es jedenfalls keine enge Korrelation zwischen Schulsystem und Testergebnissen gibt. Testergebnisse sind wahrscheinlich nicht als Indikator für die Güte eines Schulsystems geeignet.
14 Lockheed, Marlaine, und Emmanuel Jimenez, Public and Private Secondary Schools in Developing Countries, Washington 1994.
15 West, Edwin, Education Vouchers in Principle and Practice: A Survey, in: The World Bank Reseach Observer, Februar 1997.
16 Vgl. z.B. Charles Murray, Loosing Ground: American Social Policy, 1950-1980, New York 1980.
17 Vgl. z.B. Ladd, Helen, Market-based Reforms in Urban Education, Washington 2002.
18 In »Das Verhängnis der Schule« (vgl. Anm. 5) fordert Goodman, Abschluss- durch Aufnahmeprüfungen zu ersetzten; d.h. nicht eine bestandene Abschlussprüfung solle zur Berechtigung führen, eine weiterführende (Bildungs-)Institution zu besuchen; vielmehr solle die Aufnahmeprüfung ohne Voraussetzung eines an einer anderen Institution gemachten Abschlusses als alleiniges Kriterium gelten.
19 So z.B. Patrick McEwan, Martin Carnoy 2000 (vgl. Anm. 12) und Helen Ladd 2002 (vgl. Anm. 17).
20 Caroline M. Hoxby, School Choice and School Productivity, National Bureau of Economic Reseach, Working Paper 8873, April 2002.
21 Vgl. z.B. Paul Goodman, Das Verhängnis der Schule (1964), Frankfurt/M. 1975, übersetzt und kommentiert von Stefan Blankertz; Stefan Blankertz, Legitimität und Praxis, Wetzlar 1989 (Habilitation); ders., Unternehmen Schule? Überlegungen zu einer Theorie der Folgeabschätzung marktlicher Schulstrukturreformen, in: Pädagogische Korrespondenz, Heft 30, Wetzlar 2003.
22 Ingrid Lohmann, Strukturwandel der Bildung in der Informationsgesellschaft, in: Gogolin/Lenzen (Hg.), Medien-Generation, Opladen 2000.
23 Kommentar in »Die Welt« vom 25. 1. 2006, Titelseite. Die Namen der Beteiligten bleiben absichtlich ungenannt, denn die Aussagen werden hier exemplarisch behandelt.
24 In der gleichen Ausgabe der Welt auf Seite 8. In der Ausgabe vom 26. 1. 2006 gibt es eine sehr versteckte kleine Meldung, ein Lehrerverband hätte auch Bedenken angemeldet.
25 Zur entwicklungspsychologischen Dimension eingeschränkter Freiräume für unüberwachte kindliche Selbstvergesellschaftung vgl. unten den Abschnitt über Jean Piaget.
26 IHK-NRW-Pressemeldung 2000 (zum IHK-Eignungstest). IHK-Ulm 2. 6. 2002. Monster Karriere-Journal 21. 2. 2006. Vgl. auch Sven Buttelmann, Duales System auf dem Prüfstand: Das Problem der Ausbildungsreife, Diplomarbeit Hamburg 2000.
27 Meine Referenz gegenüber dem großen konservativ-libertär-marxistischen Bildungstheoretiker Heinz-Joachim Heydorn (vgl. z.B. Zu einer Neufassung des Bildungsbegriffs, Frankfurt/M. 1972).
28 Von Milton Friedman 1955 erstmals formuliert (Privatschulen sind gegen öffentliche Schulen nicht konkurrenzfähig, weil öffentliche Schulen ihre Leistung kostenlos anbieten). Dann in der Sammlung »Kapitalismus und Freiheit« (1962), Frankfurt/M. 2002. Zur Diskussion vgl. oben die Abschnitte 1.2 und 1.3.
29 Vgl. z.B. Gustav Keller, Das Klagelied vom schlechten Schüler, Heidelberg 1989: Asanger. – Jeder kennt das als das Drama der Eltern, die bei Hausaufgaben helfen sollen, das aber fachlich nicht zu leisten vermögen. – Auch in der Hoxby-Studie 2002 (vgl. Anm. 20) ist für den Zeitraum ab 1995 kein genereller Leistungsabfall zu verzeichnen.
30 Eigene Untersuchung (Zeitraum 1950 bis 1985, im Fachbereich Pädagogik/ Erziehungswissenschaft).
31 August-Wilhelm Scheer, Innovationsbeauftragter des saarländischen Ministerpräsidenten, in: Die Welt, am 6. 12. 2002, S. 9.
32 Manfred Weiß, Privatisierung des Bildungsbereichs, in: Radtke/Weiß (Hg.), Schulautonomie, Wohlfahrtsstaat und Chancengleichheit, Opladen 2000.
33 Peter Müller in: Fahrholz/Gabriel/Müller (Hg.), Nach dem Pisa-Schock, Hamburg 2002.
34 Hintergrund meiner Prozess orientierten ökonomischen Argumentation bilden Schriften der »österreichischen Schule«; vgl. besonders Ludwig von Mises, Nationalökonomie (1940), München 1980; F.A. Hayek, Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft (1946), in: ders., Individualismus und wirtschaftliche Ordnung (1952), Salzburg 1976; Murray Rothbard, Power and Market, Kansas City 1970.
35 Eine interessante Managementmethode, die paradoxer Weise versucht, die kreative Kraft des Informellen formell nutzbar zu machen, ist die »Open Space«-Konferenz. Vgl. Harrison Owen, Erweiterung des Möglichen: Die Entdeckung von Open Space, Stuttgart 2001. Eine Anleitung zur informellen Gegensteuerung ist: Stefan Blankertz, Wenn der Chef das Problem ist, Wuppertal 2004.
36 Preistheorien, die davon ausgehen, ein Preis käme durch die Summierung der Faktorenkosten zustande, sind zirkulär, da die Faktorenkosten ihrerseits erklärt werden müssten. Es ergibt sich ein unendlicher Regress, der nichts erklärt. Vgl. Ludwig von Mises, Nationalökonomie (1940), München 1980.
37 Staatliche Organisationen müssen nicht prinzipiell steuerfinanziert sein. Es gibt auch beitragsfinanzierte staatliche Organisationen wie etwa kommunale Schwimmbäder, städtische Nahverkehrsbetriebe, staatliche Versorgungsunternehmen. Die preußische Staatsschule wurde lange Zeit durch Schulgeld finanziert. Die neueren Diskussionen um Studiengebühren gehen in die gleiche Richtung. Es handelt sich bei Beitragsfinanzierung jedoch ausdrücklich nicht um die Herstellung von echten Markt-Bedingungen.
38 Erfahrungsgemäß gäbe es in diesem Falle gar keinen VW Golf, sondern einen Trabi oder bestenfalls einen Wartburg.
39 Zwei empirische Studien zur Abschätzung der Wirkung von Schulpflicht: (1.) Kevin Lang und David Kropp (Human Capital versus Sorting: The Effects of Compulsory Attendance Laws, in: The Quarterly Journal of Economics, 1986, S. 609-624) vermuten, eine Erhöhung der Pflichtschulzeit ziehe eine längere Schulbesuchsdauer von allen Schülern nach sich. Der Grund besteht darin, dass ein generell höheres Abschlussniveau der Bewerber um Arbeitsplätze die Anwärter auf bessere Jobs nötige, den nächsthöheren Abschluss zu machen. Die Autoren weisen das Humankapital-Modell zurück, nach welchem die inhaltlichen Effekte der Schulbildung für den Arbeitsplatzerwerb entscheidend sind. Ihren empirischen Daten zufolge benutzen Arbeitgeber den Schulabschluss demgegenüber eher als formales Sortierungskriterium. (2.) Joshua Angrist und Alan Krueger (Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? In: The Quarterly Journal of Economics, 1991,
S. 879-1014) schätzen, dass rund 4% der Jugendlichen eines Jahrgangs durch die Schulpflichtgesetze direkt zu einem längeren Schulbesuch als gewünscht gezwungen werden. Sie benutzen zu dieser Schätzung die Tatsache, dass sich im Kontext der meisten US-Bundesstaaten für früher im Jahr geborene Kinder eine kürzere Schulpflicht als für später im Jahr geborene Kinder ergibt. Die Differenz zwischen der Bildungsbeteiligung zwischen im ersten und im letzen Quartal eines Jahrganges geborenen Kindern lässt sich demnach auf die Wirkung der Schulpflicht zurückführen. 4% aus vornehmlich ärmeren Schichten mögen politisch uninteressant sein; für den Marktprozess können sie eine entscheidende Rolle spielen. – Zu einer seltenen pädagogischen Kritik an der Schulpflicht vgl. Ulrich Oevermann, Brauchen wir heute noch eine gesetzliche Schulpflicht?, in: Pädagogische Korrespondenz, Heft 30, 2003.

 Stefan Blankertz (Foto: Hagen Willsch)
Stefan Blankertz (Foto: Hagen Willsch)Dr. Stefan Blankertz
Sozialwissenschaftler, Coach und Schriftsteller, beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Paul Goodman und seinem theoretischen Beitrag zur Gestalttherapie.
Zusammen mit seiner Frau Isabell leitet er die »Pro Change PersonalentwicklungsGmbH« in Pulheim bei Köln. Aus dieser Tätigkeit entstand u.a. folgendes Buch: »Wenn der Chef das Problem ist. Leitfaden zur Lösungsfindung« (Klartext Verlag 1999).
Von 1993 an betreut Blankertz die Theorieeinheit in der Gestaltweiterbildung nach dem Kölner Modell am Gestalt-Institut Köln/GIK Bildungswerkstatt. Als Lesehilfe für das berühmt-berüchtige Werk von Perls, Hefferline und Goodman "Gestalttherapie" (1951, dt. München 1991) ist aus der Weiterbildung heraus entstanden und in der Edition des GIK im Peter Hammer Verlag erschienen:
"Gestalt begreifen: Ein Arbeitsbuch zur Theorie der Gestalttherapie" (3. Auflage, Wuppertal 2003). Hilarion Petzold nannte dies Buch in einer Besprechung 2001 einen "der wichtigsten Texte aus neuerer Zeit für die Gestalttherapie und die Gestaltszene".
Zusammen mit Erhard Doubrawa veröffentlichte Blankertz die "Einladung zur Gestalttherapie: Eine Einführung mit Beispielen" (3. Auflage, Wuppertal 2002) und das "Lexikon der Gestalttherapie" (Wuppertal 2005).
Soeben ist die Aufbereitung von Texten Meister Eckharts für Gestalttherapeuten erschienen: »Meister Eckhart. Heilende Texte« (siehe Buchvorstellung Seite 33f).
Seit gut vier Jahren forscht Blankertz am Gestalttypen-Indikator (GTI), um Coaching-Erfahrung und gestalttherapeutische Haltung zu integrieren.
Der hier zuerst veröffentlichte Beitrag ist die überarbeitete Fassung seines Vortrags auf der Jahrestagung des Förderkreises Gestaltkritik im Gestalt-Institut Köln, Juni 2005.

