


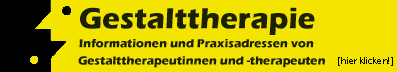
 Erhard Doubrawa
(Foto: Hagen Willsch)
Erhard Doubrawa
(Foto: Hagen Willsch)» Existentielle Augenblicke haben
eines gemeinsam: Sie erfassen im Bruchteil einer Sekunde nicht nur
exakt die gegenwärtige Wirklichkeit der Patienten, sondern auch
die der Therapeuten, und gerade das ist ausschlaggebend für den
Aufbau einer heilenden therapeutischen Beziehung. Patient und
Therapeut erleben einen existentiellen Augenblick, später noch
einen und so weiter. Daraus entwickelt sich allmählich eine
authentische Beziehung, die als das heilende Element der Therapie
gilt.« (Len Bergantino)
»Der männliche heterosexuelle Therapeut als Gegenüber von Klientinnen, die an Themen ihrer weiblichen Identität arbeiten.« - Letztes Jahr hatte ich eine so starke Grippe, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Lag fast drei Wochen nieder. Hatte gut zwei Wochen immer hohes Fieber. Währenddessen dachte ich immer wieder daran, daß ich bald einen Vortrag zu jenem Thema halten sollte.
Mir schossen Bilder und Gedanken durch meinen fiebrigen Kopf: Erfahrungen, die ich während meiner eigenen Ausbildung zum Gestalttherapeuten - voller Scham - nicht angesprochen hatte. Niemand aus den verschiedenen Trainingsgruppen, an denen ich teilgenommen habe, hatte sie übrigens angesprochen.
Los ging es dabei mit der Erinnerung an Situationen von hoher erotischer Spannung zwischen mir als Therapeuten und manchen meiner Klientinnen. Erinnerungen an Situationen, die ich sowohl als genußvoll erlebte, als auch als etwas Verbotenes, als etwas »Unanständiges«. So zum Beispiel, als ich zum ersten mal erlebte, daß ich erotische Phantasien in Bezug auf eine Klientin hatte. Daß ich sexuell erregt in einer Therapiesitzung meiner Klientin gegenübersaß und das natürlich verstecken wollte bzw. mußte. Was mir hoffentlich ganz gut gelang. Wahrscheinlich war das gerade auch in Situationen, in denen ich Erotik in meinem alltäglich Leben schmerzhaft vermißte.
Ich dachte an mein Gespräch mit Doris, einer Teilnehmerin einer kollegialen Supervisionsgruppe, damals nachdem ich gerade begonnen hatte, als Gestalttherapeut zu arbeiten. Wir warteten in ihrer Küche auf die anderen Gruppenmitglieder und tranken Kaffee. Sie erzählte mir von ähnlichen Erfahrungen während ihrer Arbeit als Atemtherapeutin. Sie sprach von ihrer sexuellen Erregung während der von ihr geleiteten Atemsitzungen.
Ich erinnerte mich, wie froh ich war, daß sie dies einfach von sich aus äußerte, ohne daß ich vorher darüber gesprochen und ohne daß ich sie danach gefragt hatte. Wie froh war ich, daß jemand anderes dies ähnlich erlebte! Wie erleichtert war ich! Es gab das auch bei anderen - erotische Spannung bis hin zur sexuellen Erregung bei der Arbeit als Therapeut. Zum ersten Mal stellte sich bei mir eine Ahnung ein, daß das ganz normal sei. Vielleicht, dachte ich, ist das völlig in Ordnung.
Auch damals habe ich mir schon die für
mich zentrale Frage gestellt: Um wen geht es eigentlich bei diesem
erotischen Erleben? Geht es dabei zuerst um mich, weil ich selbst in
meinem Leben Mangel an Erotik erlebe? Suche ich diese dann gezielt in
der Arbeit mit Klientinnen auf? Oder stelle ich mich mit diesem
meinem Erleben in den Dienst meiner Klientin? Begleite sie beim
Erforschen von Bereichen ihres Frauseins, ihrer Erotik, ihrer
Sexualität? Darf sie bei mir ihre eigene Wirkung als Frau
erfahren und erproben? Damit experimentieren und damit spielen?
Manchmal glaubte ich sehr deutlich zu spüren, daß es
letzteres war - eine Art Dienst. Wenn ich an diesen meinen Dienst
dachte, wurde ich ganz ruhig und konnte mit ihr weiterarbeiten, die
erotische Spannung zwischen uns wahrnehmen und annehmen, gar
genießen, jedoch dabei ganz klar in meinen Grenzen bleiben,
ihre Grenze nicht übertreten, nicht übergreifen.
Inge
Inge sah erheblich jünger aus, als sie es war. Ich hätte sie vielleicht auf Ende 20 geschätzt. Sie war allerdings schon fast 40 Jahre alt. Ihre Kleidung war die junger Menschen. Sie trug bestimmte Unisex-Artikel. Mein 15jähriger Neffe trägt auch solche. Seit vielleicht drei Jahren. Langsam wächst er aus ihnen heraus und trägt nun hin und wieder enge schwarze Hosen. So läßt er das geschlechtsneutrale jener Kleidung inzwischen schon hinter sich. - Inges Sprache war ruppig, so als fühlte sie sich ständig angegriffen, oder als wollte sie ständig angreifen, provozieren. Die Ringe an ihren Fingern erinnerten mich an kleine silberne Äxte.
Ich fragte sie in der Eincheckrunde, warum sie zu dem Wochenendworkshop gekommen sei, was ihr Anliegen sei. Sie berichtete davon, daß sie allein lebe und bisher immer nur kurze Männerbeziehungen gehabt hätte, meist zu erheblich jüngeren Männern. Oft seien sie mehr als zehn Jahre jünger gewesen als sie, manche sogar fünfzehn Jahre jünger. Ich war irgendwie nicht erstaunt. Nicht, daß ich das erwartet hatte. Ich spürte einfach nur kein Erstaunen darüber. Eher war es so, als würde ich eine Stimmigkeit wahrnehmen. Weiter sprach sie davon, daß sie eigentlich gerne noch Mutter werden wolle und daß es nun langsam eng für sie würde. Sie würde ihre »biologische Uhr« schon lauter ticken hören. Ich fragte nach, ob sie ihren Kinderwunsch schon länger hätte. Sie antwortete, daß er eigentlich erst seit vielleicht drei oder vier Jahren deutlich geworden wäre.
Das war erst einmal alles, was sie sagte. Es war ja nur ein kurzer Beitrag in einer Eincheckrunde. Ich möchte am Anfang eines Workshops, daß alle Teilnehmer einmal kurz zu Wort kommen - also »einchecken«, damit sie ankommen können und damit ich sie schon einmal habe sprechen hören. Es ist also eine Art erster Kontaktaufnahme. Meist aber frage ich dann bereits etwas genauer nach, nicht als bewußte Technik, vielmehr aus Interesse.
Aus dem, war wir tun, wird schließlich das wachsen, was Martin Buber das »Zwischen« genannt hat. Das Zwischen wird uns zunehmend verbinden und umfassen. Wir werden ein Teil des Zwischens werden. In diesem Feld wird dann unsere gemeinsame Arbeit stattfinden. Lore Perls hat diesbezüglich immer gesagt: »Dann wird das Ganze mehr sein, als die Summe von uns Teilen. Es wird ein Größeres sein, eine größere Gestalt.«
So schritt der Gruppenprozeß auch an diesem Wochenende voran. Nach der Eincheckrunde fragte ich, wer zuerst arbeiten wolle. Jemand meldete sich. Nach dieser Arbeit kam die nächste. Und danach wieder eine. Mit der Zeit wurde für alle im Raum spürbar, daß wir mehr und mehr zusammenwuchsen, als würden wir alle Glieder eines Organismus'. Jeder übernahm eine bestimmte Funktion. Nicht bewußt gewählt. Es geschah.
Manch einer spürte etwa die Trauer stärker, als derjenige, der gerade arbeitete. Er konnte dann über die Schmerzen, von denen der erste berichtete, weinen. Ein anderer trat in Kontakt mit dem Ärger. Derjenige, der gerade arbeitete, hatte ihn gar nicht selbst gespürt, konnte ihn jetzt jedoch aufnehmen und Erfahrungen damit sammeln. Wieder ein anderer steuerte seinen inneren Bilder zum Prozeß bei. Diese eröffneten den Zugang zu tiefem inneren Erleben.
Schließlich meldete Inge sich zu Wort. Sie wolle nun auch arbeiten. Inge sprach vom frühen Tod ihrer Mutter, als sie noch keine acht Jahre alt war. Sie war die einzige Tochter. Sonst gab es nur Brüder. Sie lebte dann als einziges weibliche Wesen in einem Männerhaushalt. Sie berichtete sehr anschaulich davon, was das bedeutete, gerade für ihr Frauwerden. Beispielsweise erzählte sie, wie es war, als sie völlig unvorbereitet und voller Scham zum ersten Mal ihre Tage bekam.
Immer wieder schoß mir während dieser Arbeit durch den Kopf: Sie erzählt das alles mir, einem männlichen Therapeuten. Ich sitze ihr als Mann gegenüber, während sie von den schlechten Erfahrungen spricht, die sie mit Männern gemacht hat. Sie muß auch Vertrauen zu Männern haben, dachte ich. Darauf kam sie später in einem Nebensatz zu sprechen. Da gab es den Großvater. Mit und bei ihm ging es ihr nämlich gut. Gottseidank.
Ich könnte jetzt von meinem inneren Prozeß berichten. Von dem Schmerz, den ich beim Zuhören spürte. Von der Scham, die für mich als männlicher Zuhörer damit verbunden war, wenn sie von schlechten Erfahrungen mit Vater und Brüdern sprach. Von meinem inneren Zögern. Meiner immer wiederkehrenden Frage, ob ich diese Arbeit tun, diese Begleitung anbieten darf. Ob mir das als Mann zusteht?
Inge hatte kaum Kontakt zu ihrer Weiblichkeit, zur weiblichen Kraft überhaupt. Ich versuchte, sie auf folgende Weise stärker in Kontakt mit dieser zu bringen, in Verbindung mit den Frauen in ihrer Familie - mit der Mutter, der Großmutter, der Urgroßmutter: Es setzten sich Frauen hinter Inge. Inge saß also vorn. Hinter sie setzt sich eine Frau so, daß Inge zwischen ihren Beinen saß. Das wäre vielleicht die Mutter von Inge. Dahinter setzte sich dann noch eine Frau in der gleichen Art. Das wäre die Großmutter. Und dann setzten sich noch mehrere Frauen dahinter.
Inzwischen ragte die Reihe der Frauen fast in die Mitte des Gruppenraumes. Mir fiel auf, daß ich gar nicht mehr hinschauen konnte, sondern immer mehr zum Boden blickte. Das war recht schwierig für mich. Denn ich wollte Inge bei dieser Arbeit natürlich auch begleiten. Aber hinschauen - das ging nicht.
Ich mich erinnerte dann an unsere archaischen Reigen-Tänze mit Beatrice Grimm, der Mitarbeiterin des Benediktiners und Zen-Lehrers Willigis Jäger. Sie hatte alte Männer- und Frauentänze aus entlegenen Regionen Südosteuropas mit uns getanzt. Wenn die Frauen aus unserer Gruppe tanzten, dann haben wir Männer die Musik dazu gemacht, d.h. wir haben gesummt, geklatscht, getrommelt. Beatrice sagte, daß Männer in diesen Kulturen, aus denen die Tänze stammen, eine Funktion für den Tanz der Frauen übernehmen müssen, wenn sie beim Tanz der Frauen dabei sein wollen. Einfach zusehen sei nicht angemessen.
So schlug ich vor, daß wir Männer tiefe Töne erzeugten, nämlich ein ganz tiefes »Ohm« sangen. Im selben Moment, als wir Männer damit begannen, konnte ich wieder hinschauen, die Frauen dort wieder anschauen und Inges Arbeit auch mit meinen Blicken weiter begleiten.
Während Inge sich nach hinten an diese Kette von Frauen anlehnte und sich zunehmend entspannte, öffnete sie ihre Beine. Sie spreizte sie. Zuerst ein wenig. Dann immer mehr. Ich dachte: Sie ist bereit zu empfangen.
Eine angenehme Wärme breitete sich bei mir in meinem Unterleib aus. Ich nahm mich explizit als Mann ihr gegenüber wahr. So wie ich gerade da saß. Ihr und den Frauen hinter ihr gegenüber. Ich freute mich über den Anblick. Wie sie da saß und wie sie auch mit den geöffneten Beinen mir gegenüber saß. Spürte meine Erregung. Gleichzeitig fühlte ich bei meinen Gedanken und meinen Gefühlen Scham.
Ich sagte mir innerlich: »Ich freue mich über die Frau mir gegenüber, so wie sie da sitzt mit ihren geöffneten Schenkeln, doch sie sind nicht für mich geöffnet. Sie sind für den Mann geöffnet, nicht für den Vater.« Ich wünschte ihr, daß sie einen guten Mann findet. Und ich freute mich für ihn, denn er würde eine gute Frau in ihr finden. Er hätte Glück mit ihr. Das spürte ich. Das war für mich fast so etwas wie ein väterlicher Segen.
Angesichts solch hoher Worte und Gedanken, verneigte ich mich innerlich, damit ich nicht stolz davon werde, sondern demütig bliebe, weil es hier um sie und nur um sie ging, um ihren Weg. Ich war nur der »Steigbügelhalter«. Gerade auch mit meinen erotischen Gefühlen und Phantasien diente ich ihr. Mehr nicht.
Wir Männer sangen weiter unser »Ohm«.
Auf einmal sagte sie: »Jetzt soll sich auch noch jemand vor mich setzen!«
»Jemand?« fragte ich.
»Nein«, antwortete sie. »Nicht jemand.« Nach eine kleinen Pause fuhr sie fort: »Es soll eine Frau sein.«
Wieder war ich nicht sonderlich überrascht. Ich spürte vielmehr die Stimmigkeit darin.
Eine weitere Teilnehmerin der Gruppe setzte sich zwischen die gespreizten Beine von Inge und lehnte sich an Inge an. Eine wunderbare Ruhe breitete sich für uns alle spürbar bei Inge aus. Inge strahlte und sah ganz weich aus.
Ich dachte: Es könnte eine Tochter sein, die sie zur Welt bringt.
Wir Männer sangen weiter unser »Ohm«.
Ich war sehr gerührt. Das bin ich auch jetzt noch, wenn ich daran denke.
Ganz hinten, hinter der Reihe der Frauen, saß übrigens ein Mann. Allerdings umgekehrt. Die letzte Frau lehnte sich an seinen Rücken an. Das »mußten« wir einfach so machen. Sonst wären die Frauen ja umgekippt. So sah es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Und auf den zweiten? Da wurde mir das Bild schon noch klarer. Das war die Aufgabe dieses Mannes: Er diente dem Weiblichen. Er stützte und er trug es.
Übrigens: Inge hat wirklich eine
gesunde Tochter zur Welt gebracht. Mit gut 43 Jahren. Nach einer
leichten und schönen Schwangerschaft, wie sie mir in einem Brief
schrieb, dem sie ein Foto ihrer Tochter beilegte. Sie hatte bald nach
dem Workshop einen Mann kennengelernt und wurde gut drei Jahre
später endlich Mutter.
Der Tanz der Tochter vor dem Vater
Mein Lehrer Hunter Beaumont erzählte einmal von der Tochter, die vor ihrem Vater tanzt. Sie sieht sich und ihre Wirkung als werdende Frau in den Augen ihres Vaters. Er ist Vater, gleichzeitig spürt er sein Begehren. Doch er ist der Vater und sich dessen ganz bewußt. Er weiß um seine Grenzen. Sie kann ihn reizen. Er findet sie reizend. Doch er greift nicht über. So sollte es jedenfalls sein. Dann kann sie ihr Frauwerden und Frausein in diesem Schutzraum der Väterlichkeit üben.
Ich stelle mir vor, daß dies vielleicht die angemessene Haltung ist, mit der ein männlicher Therapeut als Gegenüber mit einer Klientin arbeitet.
- Eingefügt nach einem Telefongespräch mit meiner Kollegin und Freundin Heidi Schoeller: Der Vater spürt die Aufregung und sein Begehren. Er genießt das - und er tritt nicht über. Aus seinem Erleben erfolgt keine Annäherung an die Tochter als Frau. Wenn der Vater in diesem Moment Unklarheit bei sich erlebt, dann muß er sich zurückziehen, denn dann kann er seiner Tochter nicht diesen Schutzraum bieten, den ich eben gerade beschrieben habe. -
Das kann manchmal auch schmerzliche Erfahrungen für die Tochter mit sich bringen. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Klienten daran gearbeitet, daß sich ihr Vater auf einmal abrupt von ihr »abwandte«, als sie ungefähr dreizehn oder vierzehn Jahre alt war. Über diesen Rückzug ihres Vaters hat sie viel Schmerz empfunden. Sie beschrieb das so, als sei damals etwas in ihr »kaputtgegangen«. Seitdem erlebte sie einen Mangel an Selbstwertgefühl und sie hatte den Eindruck, etwas mit ihrer weiblichen Attraktivität sei nicht in Ordnung. Sie sagte, daß sie ihre Weiblichkeit einfach nicht (mehr) leben könne.
Ich habe mir diesen Schmerz angehört. Es war auch etwas Scham im Raum. Sie sagte schließlich: »Ja, ich wollte meinen Vater damals auch reizen mit dem, wie ich ihm gegenübertrat.«
In dieser Arbeit habe ich ihr vorgeschlagen,
sich vorzustellen, daß sich ihr Vater von ihr habe
zurückziehen müssen, weil er sich seiner Grenzen ihr
gegenüber nicht sicher war. Der Rückzug war vielleicht
gerade ein Zeichen seiner Väterlichkeit - sein Versuch, sie vor
seinen Empfindungen zu schützen. Diese Vorstellung hatte eine
erstaunlich lösende Wirkung. Die Teilnehmerin fand nämlich
im Laufe des Prozesses wieder zu ihrer Liebe zu ihrem Vater, so wie
sie damals gewesen war, bevor sich ihr Vater - scheinbar! - von ihr
»abgewandt« hatte.
Angela und der »junge Mann«
Vor gut einem Jahr holte sich Angela bei mir Supervision für ihre Arbeit mit einem ihrer Klienten. Als sie verlegen zu erzählen begann, sagte sie, daß es um einen »jungen Mann« gehe. Unmittelbar mußte ich grinsen und hätte am liebsten zu feixen begonnen, so albern war mir in diesem Moment zumute. Ich sagte ihr das. Sie antwortete mir, daß der »junge Mann« Anfang 40 und ein ausgebildeter Psychotherapeut sei.
Bei mir gingen im selben Moment die tollsten Phantasien durch den Kopf. Meine Supervisandin ist nur wenige Jahre älter als »der junge Mann«. Sie hat sich vor einigen Monaten von ihrem Ehemann getrennt. Fand da ein Flirt statt? Ein heftiger Flirt vielleicht? Doch weit gefehlt, wie der weitere Supervisionsprozeß zeigen sollte. Ich war zu schnell vom Phänomen zur Deutung gesprungen.
In der Tat war Verlegenheit, ja Scham im Raum. Auch meine Supervisandin fühlte sie. Doch diese Scham war keine neurotische. Es war eine existentielle!
Existentielle Scham? Ja, dann ist Scham ein Zeichen von großer seelischer Tiefe, sogar ein »Gradmesser« der seelischen Tiefe. Existentielle Scham geht mit wesentlichen Themen einher. Sie gehört zum seelischen »Spiraltanz«, der spiralförmigen Annäherung zum Wesentlichen, zu unserem Wesen, zu unserem Wesenskern.
- Der Begriff »Spiraltanz« stammt übrigens vom amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell, der für diesen Bereich genauso bedeutsam war wie der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung. Joseph Campbell hat die Mythen der Völker rund um den Globus gesammelt und erforscht. Und er hat dabei zwei Grundmythen herausgefunden, die in allen Kulturen auf der Erde vorkommen: Den ersten Grundmythos hat er »Heldenreise« genannt und dem männlichen Prinzip zugeordnet. Ein »modernes« Beispiel für eine solche »Heldenreise« ist übrigens die Filmtrilogie »Krieg der Sterne«, den Campbells wichtigster Schüler George Lucas gedreht hat. Den zweiten Grundmythos, den weiblichen, nannte Campbell »Spiraltanz«. Und er hat den »Spiraltanz« als »Heldenreise« nach innen zur Seele beschrieben. -
Meine Klientin begann von dem »jungen Mann« zu berichten. Er sei sehr religiös erzogen worden, pietistisch, also lustfeindlich. Vor etwa einem Jahr hatte er sich von seiner Frau getrennt, mit der er fast 20 Jahre verheiratet gewesen war. Sie war seine erste und einzige Sexualpartnerin in seinem Leben. Nicht lange nach dem Tod seines Vaters zog er aus dem kleinen Dorf weg, wo er seit seiner Geburt immer in unmittelbarer Nähe zu seiner Herkunftsfamilie gelebt hatte, zuletzt im Haus der Eltern. Unsicher und unerfahren kam »der junge Mann« jetzt in die große Stadt.
Während sie berichtete, wurde mir weich und warm ums Herz. Hatte ich vorher eher meinen Unterleib gespürt, so nahm ich nun deutlich wahr, wie sich mein Brustraum weitete und öffnete. Meine Supervisandin war weiterhin verlegen und scheu. Es wirkte so, als fürchtete sie, sie könne vielleicht ihrem Klienten gegenüber etwas falsch machen.
Auf meine Intervention hin berichtete sie weiter von ihrem eigenen inneren Erleben bei der Arbeit mit dem »jungen Mann«: Sie wolle ihn beschützen, ihm beistehen. Sie mache sich Sorgen um ihn, daß man ihn schlecht behandeln oder sich über seine Naivität lustig machen könnte. Seine Unerfahrenheit könnte ausgenutzt werden. Dann sprach sie das entscheidende Wort aus: Sie fühle Fürsorglichkeit ihm gegenüber.
Die Wirkung ihres Berichtes war so, daß ich väterliche Gefühle meiner Supervisandin gegenüber hatte. Ich fragte nach, ob es vielleicht Mütterlichkeit sei, die sie ihrem Klienten gegenüber empfinden würde. Sie hielt ein wenig inne, spürte in sich nach und bejahte dies mit Tränen in den Augen.
Sie sagte, daß sie ihre Mütterlichkeit im Verhältnis zu ihren eigenen Kindern gut kenne. Sie ist Mutter von drei Kindern, zwei Töchtern und einem Sohn. Sie sei ganz erleichtert, ihr Verhältnis zu ihrem Klienten als ein mütterliches zu verstehen. Dies habe eine gute Wirkung. Sie spüre nun weniger ihren Unterleib als vielmehr ihre Brust. Es handele sich um fast so ein Ziehen, wie sie es davon kenne, als sie ihre Kinder stillte. Wieder war sie verlegen, doch fuhr fort: »Dann, wenn die Milch einschießt«.
Dann sagte sie, daß sie die Antwort auf ihre Frage in diesem Supervisionsprozeß schon gefunden habe, nämlich ob diese Empfindungen, die sie ihrem Klienten gegenüber habe, in Ordnung seien. Sie seien es. Sie spüre Freue darüber und empfinde »eine tiefe Liebe« für ihren Klienten. Sie wisse nicht, wie sie es anders angemessen ausdrücken solle.
Eine tiefe Liebe - mit einer erotischen Komponente, einem erotischen Beiklang, den sie durchaus auch genießen würde. Doch klar sei, daß da nichts weiters zwischen ihnen entstehen werde. Da sei sie sich wirklich ganz klar!
Ja, auch dieses Empfinden kenne sie von sich in Bezug auf ihrem heranwachsenden Sohn.
Sie sei vorher irritiert von ihrem inneren Erleben gewesen. Sie hätte nicht gewußt, wie sie ihre gut gemeinten Ratschläge, die sie ihm für seinen Weg durch den Großstadt-Dschungel geben, aber auch ihre Warnungen, die sie aussprechen wollte, vor dem Hintergrund einer Mann-Frau-Beziehung verstehen sollte.
So endete der Supervisionsprozeß mit Angela.
In der nächsten Supervisionssitzung konnte sie dann davon berichten, wie der »junge Mann« nun durchs Leben und durch den Dschungel der Großstadt zog. Er hatte immer eine Tüte Präser in der Hose. Sie hat ihm das, so unerfahren wie er war, dringend nahe gelegt. Mütter tun das manchmal, wenn der Vater das nicht tut. Und der war ja schließlich nicht mehr da.
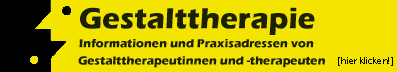
Erhard Doubrawa
Jahrgang 1955, Gestalttherapeut, Diplom-Pädagoge und Diplom-Sozialpädagoge grad., Studium der Erwachsenenbildung, Kath. Theologie und Publizistik.
Er ist Gründer und Leiter des »Gestalt-Instituts Köln/GIK Bildungswerkstatt«, wo er auch als Ausbilder tätig ist.
Außerdem gibt er die Zeitschrift »Gestaltkritik« heraus. Im Peter Hammer Verlag ediert er zusammen mit seiner Frau Anke, einer niedergelassenen Psychotherapeutin, eine Reihe zur Theorie und Praxis der Gestalttherapie.
Gemeinsam mit Stefan Blankertz veröffentlichte er "Einladung zur Gestalttherapie. Eine Einführung mit Beispielen" (Peter Hammer Verlag 2000).
Und gemeinsam mit Frank-M. Staemmler gab er eine Aufsatzsammlung zur Bedeutung Martin Bubers für die Gestalttherapie heraus: "Heilende Beziehung. Dialogische Gestalttherapie" (Peter Hammer Verlag 1999).
Der hier veröffentlichte Beitrag ist die überarbeitete Fassung seines Vortrages anläßlich der Jahrestagung 2001 des »Förderkreises Gestaltkritik« am 12. 5. 2001 im Gestalt-Institut Köln/GIK Bildungswerkstatt.
Er ist zuerst erschienen in: Erhard Doubrawa, »Die Seele berühren. Erzählte Gestalttherapie«, Edition Gestalt-Institut Köln / GIK Bildungswerkstatt im Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2002, 123 Seiten, broschiert, 11,90 €.

