


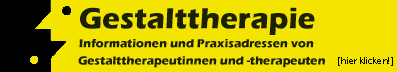

Daniel Rosenblatt (DR): In einem Monat wirst Du nach Europa fahren. Was hast Du dort vor?
Laura Perls (LP): Ich will drei größere Workshops in meiner Heimatstadt Pforzheim abhalten. Gerade um die Ecke von den Freunden, bei denen ich während meiner Besuche immer logiere, hat ein junger Gestalttherapeut ein Haus gekauft und sich niedergelassen. Ich werde es also ganz bequem haben. Nicht einmal ein Auto brauche ich, weil es zu ihm gerade fünf Minuten zu Fuß sind.
DR: Was für ein Gefühl hast Du dabei, wieder nach Pforzheim zu kommen?
LP: Ich habe mich wieder daran gewöhnt. Ich habe mich zwar bei den ersten Besuchen erst wieder einfinden müssen, nachdem ich seit 1933 nicht mehr da war, abgesehen von ein paar Tagen 1957. Aber jetzt fühle ich mich dort wieder zu Hause, wirklich. Ich habe auch noch einige alte Freunde dort. Genau genommen sind sie überhaupt die einzigen alten Freunde meiner Generation, die ich habe. Sie kannten mich schon, als ich noch ein Kind war, und sie kannten meine Eltern und meine Familie. Und darum ist es mit ihnen wie zu Hause.
DR: Wie anders ist Deutschland heute im Vergleich zu der Zeit, als Du dort lebtest?
LP: Damals, als ich studierte, war Frankfurt natürlich noch die fortschrittlichste Universität in Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa. Doch als Hitler an die Macht kam, verlor sofort der ganze Lehrkörper seine Stellen. Die meisten emigrierten nach New York und gründeten eine Exil-Universität, die dann nach kurzem mit der New School fusionierte. In Frankfurt waren damals auch Kurt Goldstein [1878 - 1965], Max Wertheimer [1880-1943] und Martin Buber [1878-1965]
DR: Ja, und sie alle waren wichtige Personen für die Gestalttherapie.
LP: Ja, richtig.
DR: Und für ihre Entstehung.
LP: An der Universität Frankfurt hatte ich mein ganzes Psychologiestudium absolviert.
DR: Die Vorgeschichte der Gestalttherapie ist sicher ein Thema, das viele sehr interessiert. Und eben hast Du schon Deinen psychologischen Hintergrund in Frankfurt angesprochen.
LP: Also zur Psychologie bin ich erst ziemlich spät gekommen. Zunächst hatte ich Jura und Volkswirtschaft studiert, und ich wollte mich auf Familienrecht spezialisieren. Das war damals gerade erst entstanden. Ich war auch eine der ersten Frauen überhaupt, die Jura studierten. Aber dann packten mich die psychologischen Aspekte meiner Gebiete immer mehr, und ich wechselte das Fach. Eigentlich habe ich eine Aversion gegen Jura und Wirtschaft genau wie gegen das Geschäftsleben, das ich ja schon als ganz kleines Kind miterlebte. Das Geschäft war im Erdgeschoss, die Wohnung in der ersten Etage, und ich ging im Alter von zwei oder drei Jahren jeden Tag nach unten, um zu helfen - schon damals meine Berufung (lachend). Dann kam mein Bruder auf die Welt, und ich half nie mehr aus.
DR: Du hast also Deine frühen Geschäftserfahrungen gehasst.
LP: Ja. Hättest Du das nicht?
DR: Und deine juristische Erfahrung links liegen lassen. Es gibt aber eine andere Lernerfahrung, die Dir sehr wichtig wurde: Musik. Und Literatur.
LP: Musik war für mich am wichtigsten. Meine Mutter konnte ziemlich gut Klavier spielen. Ich selbst fing damit an, als ich fünf war. Ich konnte Noten schon lange vor irgend etwas anderem lesen. Mit meiner Mutter zusammen spielte ich vierhändig. Als ich zwölf oder vierzehn Jahre war, spielte ich sogar besser als sie. Aber von sonst etwas anderem verstand ich bis dahin nichts. Erst dann entwickelte ich allmählich ein Interesse für Philosophie, Sprachen, Psychologie und viele andere Gebiete.
DR: Du sprichst von Musik als früher Lernerfahrung. Was für einen Einfluss hatte die denn Deiner Ansicht nach auf Deine Arbeit mit Gestalttherapie?
LP: Sie ging einher mit der Körperarbeit, in der ich mich schon früh übte. Zum ersten Mal war das im Alter von acht Jahren. Später praktizierte ich eine andere Form von Eurythmie und modernem Tanz, und dabei blieb ich mein ganzes Leben lang. Ich mache heute noch einige der zugehörigen Übungen, denn das hält mich in Form. Auch in meinen Gruppen arbeite ich viel damit. Meiner Meinung nach ist dies eine grundlegende Form der Unterstützung.
DR: Mit Wilhelm Reich hast zwar Du nicht selber gearbeitet, aber Fritz hatte es und hat auch über den Körperpanzer geredet. Weißt du noch, ob du Verbindungen zwischen dem, worüber er redete, und Deinem eigenen Hintergrund hergestellt hast?
LP: Für mich fügte sich das wie selbstverständlich zusammen, und es passte auch gut zu Goldsteins Konzept vom Organismus als Ganzheit.
DR: Du sagtest, der Körper stellt ein System der Unterstützung dar. Könntest Du das etwas weiter ausführen und erklären, wie es mit dem Konzept des Organismus als Ganzheit genauer zusammenhängt?
LP: Genau genommen richte ich mein Augenmerk auf Feinkoordination und aufrechte Haltung. Die Bewegungen und Arbeitsabläufe des Körpers sollen ihre Unterstützung aus dem Unterbau und der Atmung beziehen, so dass die obere Körperhälfte dafür frei wird, sich in der Umgebung zu orientieren und in sie handelnd einzugreifen. Würde man hingegen versuchen, sich aus dem Schulter- und Nackenbereich heraus aufrecht zu halten, so würde man hier oben (zeigt auf den Nackenbereich) versteifen und wäre nicht mehr wirklich frei.
DR: Damit führst Du sehr deutlich vor Augen, wie sich Disharmonien und Störungen daraus entwickeln können, dass man sich nicht an der richtigen Stelle Unterstützung verschafft.
LP: Richtig. Von daher sind alle Störungen, genau genommen alle erworbenen Störungen, im willkürlichen Muskelsystem angesiedelt. Viele Einzelheiten darüber lernten wir durch Reich. Aber gewusst hatte ich es schon lange zuvor durch meine Erfahrung mit dem Tanz.
DR: Wenn Du sagst, dass sich Störungen aus dem willkürlichen Muskelsystem entwickeln, erinnere ich mich an die Theorie, dass jede Emotion mit einer für sie typischen Muskelreaktion einhergehe. Bei Ärger und Ekel seien dies körperliche Reaktionen. Wie viel davon hältst Du auch heute noch aufrecht, bzw. hast Du daran überhaupt etwas modifiziert?
LP: Also, zunächst gibt es eine primäre automatische Reaktion: Wenn man etwas schluckt, das unverdaubar ist, kommt es wieder hoch und wird ... herausgewürgt. Daraus entwickelt sich ein allgemeines Muster, wie etwas aufgenommen wird, sei es seelisch, geistig oder gefühlsmäßig. Introjektion. Freud glaubte, dass Lernen überhaupt durch Introjektion erfolge. Aber das ist nur ein sehr eingeschränktes Lernen, und es findet auch nur in sehr frühen Entwicklungsphasen statt. Danach entwickelt sich aber ein Muster aus der Art, wie man mit fester Nahrung verfährt: entweder Kauen und Durcharbeiten...
DR: Ja, das war für mich immer eine der großen Offenbarungen der Gestalttherapie, wie Du und Fritz sie lehrten, dass Zerstörung eine Notwendigkeit ist.
LP: Ich verwende lieber die Bezeichnung "De-Strukturierung", weil in "Zerstörung" auch Feindseligkeit mitschwingt. Dagegen benennt Destrukturierung und Restrukturierung die Bewegungskräfte, durch die man wächst.
DR: Na gut, ich nahm das etwas wörtlicher und hielt mich an den Prozess der Nahrungsaufnahme. Technisch gesprochen ist das natürlich eine Destrukturierung, aber konkret besteht die Aufnahme fester Nahrung darin, dass man sie mit den Zähnen in kleinste Bestandteile zerbeißt.
LP: Das wurde in "Das Ich, der Hunger und die Aggression" dargelegt.
DR: Ich war damals sehr beeindruckt von dem Gedanken, dass man etwas zerreißen und zerbrechen kann, es destrukturieren und zerstören kann, und am Ende entsteht daraus doch etwas Gutes. Solch ein Akt braucht nicht blind, feindselig oder böse zu sein, sondern kann einen notwendigen Schritt darstellen, um eine neue Form von Geordnetheit zu erzeugen.
LP: Ich fing an, mich dafür zu interessieren, als ich in Berlin mein erstes Kind hatte. Darüber kam ich zu einer genaueren Beschäftigung mit Stillen und Entwöhnen von Kindern.
DR: Und dies war einer der ersten Anfänge, über die traditionelle Psychoanalyse hinauszugehen.
LP: Fritz verarbeitete meine Notizen darüber zu einem Vortrag, den er 1936 beim Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Marienbad hielt, und diesen baute er zu dem Abschnitt über geistig-seelischen Stoffwechsel in "Das Ich, der Hunger und die Aggression" aus.
DR: Dann hast Du auch über Ersatzhandlungen gearbeitet.
LP: Ich schrieb das Kapitel über den Schnullerkomplex und das Kapitel über Schlaflosigkeit.
DR: Wenn das 1936 begann und wir jetzt 1984 haben, dann sind seither 50 Jahre...
LP: Damals nannten wir das eine Revision der Freud'schen Analyse und uns selber immer noch Psychoanalytiker. Der Ausdruck "Gestalttherapie" kam erst mit dem nächsten Buch auf, das zusammen mit Paul Goodman entstand.
DR: Wie kam es dazu, dass ihr die Bezeichnung "revidierte Psychoanalyse" durch "Gestalttherapie" ersetztet?
LP: Eigentlich wollte ich das, was wir machten, als "existenzielle Therapie" bezeichnen. Aber damals verstand man "Existenzialismus" vor allem im Sinne von Sartre und gewissen nihilistischen Strömungen. Deshalb wollten es Fritz oder Paul mit "Gestalttherapie" probieren.
DR: Weißt Du noch, wer von den beiden?
LP: Ich weiß es nicht mehr. Ich hielt mich damals weitgehend heraus. Als wir das Institut gründeten, wollte ich auf keinen Fall ins Leitungsteam gehen. Ich hatte ja noch nie gelehrt, und ich war schon überlastet mit meiner Praxis und einer wöchentlichen Fahrt nach Philadelphia, und ich hatte ja auch noch die Kinder im Haus.
DR: Du erwähntest die Gründung des Instituts. Was war Dein Beitrag dazu?
LP: Wir besprachen alles miteinander. Ich kann heute nur schwer sagen, wer genau was einbrachte. In jedem Fall war der Einfluss von Paul Goodman sehr bedeutend. Ohne ihn würde es wohl überhaupt keine zusammenhängende Theorie der Gestalttherapie geben.
DR: Als ich Dich zum ersten Mal traf, hatte ich von Euch als "diesen links-orientierten Psychoanalytikern Fritz und Laura Perls" gehört.
LP: In Südafrika hatten wir dreizehn Jahre lang ohne direkte Anbindung an irgendeine psychoanalytische Gruppe und ohne Aufsicht gearbeitet. Wir hatten machen können was wir wollten. Über den streng psychoanalytischen Arbeitsansatz hatten wir herausgefunden, dass er in vielen Fällen unzureichend war und nur wenig bewirkte. Manche unserer Patienten waren zehn oder zwölf Jahre in Analyse und erlebten dabei nur gewisse Verbesserungen, aber keine wirklich grundlegende Veränderung. Ich fand auch, dass das auf Dauer langweilig wurde. Die psychoanalytische Technik vermeidet Verlegenheiten und Unannehmlichkeiten auf Seiten des Therapeuten wie des Patienten. Der Patient redet zur Wand, der Therapeut sitzt hinter ihm, und sie begegnen sich nie von Angesicht zu Angesicht. Es gibt überhaupt keinen persönlichen Kontakt zwischen ihnen.
DR: Das klingt, als ob es nicht einmal eine gute Konfluenz zwischen den beiden gäbe. Jeder ist mit sich selbst allein.
LP: Natürlich nicht. Es bestehen dort viele Trennungen und unklare Abgrenzungen, wodurch beim Patienten die Introjektion sogar noch zunimmt.
DR: Wenn Dir die psychoanalytische Arbeit in Deiner Praxis so viel Unbehagen bereitete während sich gleichzeitig bei Dir und bei Fritz neue theoretische Auffassungen entwickelten, wann hast Du oder Fritz oder Ihr beide zusammen mit Paul ernsthaft drüber nachgedacht, Euch von der Psychoanalyse zu lösen und einen Neuanfang zu machen?
LP: Es zeichnete sich in Südafrika nur ganz allmählich ab. Aber nachdem wir hier angekommen waren und Paul Goodman kennen gelernt hatten, begann fast sofort die Arbeit an "Gestalttherapie". Damals war Paul übrigens noch in einer Reichianischen Analyse. In Südafrika hatte ich seine kritischen Artikel gelesen, die er in der Zeitschrift "Politics" von Dwight McDonald veröffentlichte.
DR: Als Ihr drei zusammenfandet, hattet Ihr also einen starken gemeinsamen Hintergrund und ein Interesse an Psychoanalyse...
LP: ... an Reichianischer Analyse, die ja schon eine Abweichung darstellte.
DR: Und Reich war damals selber in New York.
LP: Ja, aber als Fritz ihn in seiner Bleibe irgendwo draußen im Staat New York besuchte, trat er sehr hochtrabend auf war irgendwie beleidigt, dass wir über seine Orgontheorie nichts wussten. Dabei bekamen wir in Südafrika gar keine Bücher. Wir bekamen ja kaum Post aus Amerika, und schon gar nichts über Reichs Arbeit in den Vereinigten Staaten. Ich bin auch nicht so sehr Naturwissenschaftlerin. Reich war viel stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet, er war ein richtiger Biologe. Ich habe Reich auch nur einmal getroffen. Ich kannte ihn persönlich gar nicht. Fritz war früher etwa zwei Jahre lang bei ihm in Lehranalyse gewesen und war von ihm absolut fasziniert. Er hätte auch gerne bei ihm weitergemacht. Aber dann kam Hitler an die Macht, und Reich kam noch vor uns aus Deutschland raus.
DR: Ich erinnere mich, dass Fritz sagte: "Ich hatte vier Therapeuten. Mit Abstand der beste von ihnen war Wilhelm Reich".
LP: Oh ja, er hat wohl viel von ihm profitiert. Mit einem streng Freudianischen Ansatz konnte man nicht weiterkommen. Selbst in meiner Analyse bei Carl Landauer, die in vieler Hinsicht bessser war als Fritz' Freudianische Analyse, kamen bestimmte Themen überhaupt nie richtig auf.
DR: Was hat Fritz Deiner Meinung nach aus der Reichianischen Arbeit mitgenommen, das für die Entwicklung der Gestalttherapie nützlich war?
LP: Die ganze Theorie über Charakter und Abwehrmechanismen,. Wir waren damals beide sehr von der Charakteranalyse beeinflusst, die Reich just in der Zeit veröffentlichte, als Fritz bei ihm in Analyse war.
DR: Wobei sich Gestalttherapie ja kaum über Charakter äußert.
LP: Charakter ist eine fixierte Gestalt. Wobei wir hier auch auf den Reich'schen Terminus der "Fixierung" von Muskeln zurückgreifen.
DR: Ich denke an Stil, der ja auch eine fixierte Gestalt ist. Über Stil wird von Gestalttherapeuten viel häufiger gesprochen.
LP: Stil ist etwas, das sich entwickelt. Stil ist etwas anderes als Charakter. Stil ist stärker integriert in Ausdruck, Verhalten und Funktionieren.
DR: Du sagtest, Charakter ist eine fixierte Gestalt, also nicht etwas, das sich gar nicht erst entwickelt und dann unveränderlich wird. Sondern es findet eine Entwicklung statt, die zuletzt erstarrt.
LP: Normalerweise diente das, was jetzt als eine bestimmte Form der Begrenzung, Einengung, Verdrängung oder Fixierung auftritt, zuvor als Unterstützung für etwas. Jeder Widerstand hatte ursprünglich eine Funktion der Unterstützung.
DR: Du hast ja Reichs Konzept des Charakters bereits erwähnt. Was ist denn mit dem Körperpanzer? Mit Anklammern und Festhalten?
LP: Das ist das System zur Unterstützung des Charakters. Wenn jemand einen bestimmten Charakter hat, bedeutet das, er hat feste Formen des Ausdrucks, Verhaltens und Funktionierens.
DR: Ich versuche, zwischen einem seelischen und einem leiblichen Charakter zu unterscheiden.
LP: Sie sind identisch. Der eine geht mit dem andern einher. Wenn man in der Therapie die Aufmerksamkeit auf die vorhandenen Verfestigungen und Muskelverspannungen lenkt, kommt auch die zugehörige seelische Seite hoch. Indem ich mit den Fixierungen und Verspannungen beginne, die für mich unmittelbar sichtbar sind, sie dem Klienten wahrnehmbar und erlebbar werden lasse, und dann dem weiteren Prozess folge, gelange ich bis zum eigentlichen Kern des Konflikts.
DR: Mir scheint, mit diesem Weg bist du vom Konzept des Charakters abgekommen. Nicht, dass ich Einwände dagegen hätte. Vielmehr scheint mir das einer der Vorteile, den Gestalttherapie bietet. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was unmittelbar gegeben ist, müssen wir solche Begriffsbildungen gar nicht erst einführen.
LP: Charakter impliziert für mich, dass alle Fixierungen, die den Charakter unterstützen, zur Aufgabe der fortlaufenden Gestaltbildungen werden.
DR: Würdest Du dann sagen, dass Gestalttherapie durch Fokussierung und Bearbeitung der unmittelbar sichtbaren Verspannungen gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was zu dem darüber hinausgehenden Bereich des Charakterpanzers gehört, weil sich der schon vorher auflöst oder wandelt oder integriert wird? Auf der einen Seite ist Reich mit all diesen diagnostischen Bildern und dem schweren psychoanalytischen Begriffsapparat. Dagegen Gestalttherapie ...
LP: Ich glaube, das ist alles gar nicht nötig. Denn in Gestalttherapie versuchen wir, die Fixierungen, die gewissermaßen zu einem Daseinzustand versteinert sind, wieder in den Vordergrund zu holen. Dadurch können sie als eine Aktivität erlebt werden, die gerade momentan getan wird, nämlich mit Hilfe der beteiligten willkürlichen Muskulatur. Wenn man erst einmal sagen kann "Ich verspanne mich. Ich versteife mich. Ich unterbreche meine Atmung", dann kann man auch wieder alternative Verhaltensweisen ausprobieren. Sehr oft tauchen dann auch Erinnerungen auf, nämlich daran, wie man sich mal ursprünglich in eine bestimmte Weise der Fixierung begab.
DR: Was hältst du von Freuds Theorie, dass man sich wiedererinnern müsse, die Erinnerung durcharbeiten müsse, und dann fortschreiten könne?
LP: Wenn die Erinnerungen dabei auftauchen, dass Träume oder Fantasien gedeutet werden, während jedoch gleichzeitig die Muskelspannungen fortbestehen, dann kann man mit ihnen nicht viel anfangen. Entweder glaubt man die Deutung und introjiziert sie. Oder man weist sie zurück und verdrängt sie wieder. Darum führt eine voreilige Deutung durch den Therapeuten sehr oft zu dem, was schon Freud als negative therapeutische Reaktion bezeichnete. Wenn sich der Klient allerdings mit seinem Widerstand identifiziert, kann er zu einer eigenen Deutung gelangen. Sie ist dann seine unmittelbare Erfahrung.
DR: Das ist ein weiterer fruchtbarer Aspekt der Gestalttherapie, bei dem ich mich immer gefragt habe, wie er entstanden ist: Das Verständnis von Widerstand als einer kreativen Aktivität der Persönlichkeit.
LP: Widerstand war ursprünglich Unterstützung für etwas. Und für was ist er eine Unterstützung? Für was ist er gut? Was nützt er Dir? Oder für was war er vielleicht früher einmal nützlich und ist es heute nicht mehr?
DR: Von wem stammt diese Vorstellung? Wie entstand sie? Kannst Du Dich daran erinnern? Die kreative Natur des Widerstands und die Methode, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, das ist einer der revolutionärsten Züge der Behandlung in der Gestalttherapie.
LP: Das weiß ich nicht mehr genau. Wir tauschten uns ja fortlaufend über unsere Arbeit aus, da kann ich wirklich nicht mehr sagen, wer was zuerst gedacht hat.
DR: Wenn Du sagst "unsere Arbeit", wer ist dann mit "uns" gemeint?
LP: Zuerst waren das Fritz und ich in Südafrika, wo ich an "Das Ich, der Hunger und die Aggression" in allen Teilen mitarbeitete.
DR: Wie fand in dieser Zeit die Kommunikation zwischen Euch statt? Beim Essen, beim Frühstück, im Bett, oder wie?
LP: Das war meistens am Wochenende, denn Fritz war während der Arbeit an "Das Ich, der Hunger und die Aggression" beim Militär. Sein Standort war das Militärkrankenhaus in Potchefstroom fünfzig Kilometer vor Johannesburg. Dort diskutierte er seine Ideen mit seinen Kollegen, und wenn er am Wochenende zu Hause war, sprachen wir darüber. Es war auch noch ein Freund von uns beteiligt, ein holländischer Schriftsteller und Journalist, der zu unserem besten Freund wurde. Er half uns beim Englisch aus, weil das Englisch von Fritz überhaupt nicht gut war. Fritz konnte Englisch schon länger als ich und war auch im Mündlichen besser als ich, aber im Schriftlichen wurde schon bald ich die bessere.
DR: Wie hieß Euer holländischer Freund?
LP: Er hieß Hugo Posturnys, hatte aber den Spitznamen Jumbo und wurde so auch in unserem Bekanntenkreis genannt. Er war ein heller Kopf und sehr interessanter Mann, der sieben Sprachen beherrschte.
DR: Du hast erwähnt, dass auch noch einige andere an der Entwicklung der Ideen Anteil hatten, die in "Das Ich, der Hunger und die Aggression" niedergelegt sind.
LP: "Holismus und Evolution" von Smuts. Seinerzeit war Fritz von ihm sehr beeindruckt. Er hat sich mit Smuts auch ein- oder zweimal getroffen, und Smuts hatte ihm sogar zugesagt, eine Einleitung zu "Das Ich, der Hunger und die Aggression" zu schreiben. Aber dann brach der Krieg aus, und da hatte er natürlich keine Zeit mehr dafür. So mussten wir es halt so herausbringen.
DR: In "Das Ich, der Hunger und die Aggression" habt Ihr die Bezeichnung "Konzentrationstherapie" benutzt.
LP: Wir sagten Konzentration im Gegensatz zu Assoziation in der Therapie.
DR: Dabei stand also vor allem die Technik im Vordergrund.
LP: Ja, und Gendlin würde heute "Fokussierung" dazu sagen.
DR: Es handelt sich dabei wohl immer auch um ein Element im Kontinuum des Gewahrseins. Suche Dir etwas heraus, mit dem Du Dich mehr befassen kannst, und bleib dann dabei, anstatt immer weiteren Einfällen nachzugehen.
LP: Das Kontinuum des Gewahrseins wird heutzutage in der Gestalttherapie oft falsch verstanden. Manche Leute sagen, sie würden damit arbeiten, obwohl es sich eher um freie Assoziation oder Dissoziation handelt, bei der man von einem Gegenstand zum nächsten hüpft. Jetzt bin ich mir gewahr, dass dies. Jetzt bin ich mir gewahr, dass jenes. Tatsächlich jedoch entwickelt sich das Kontinuum des Gewahrseins erst richtig, wenn man Blockaden beseitigt oder löst, Muskelverspannung, Störungen, fixierte Gestalten. Man konzentriert sich auf die fixierten Gestalten und wie man sie fixiert.
DR: Als ich einige Bänder von Fritz' Arbeit in Esalen sah, ging er dort anscheinend so vor, wie Du vorhin sagtest.
LP: Ja, und ich glaube, das war falsch. Fritz war stärker analytisch ausgerichtet als er meinte. Der heiße Stuhl, der leere Stuhl und das Dirigieren des Klienten nach seinen eigenen Deutungen ist eine Art Dramatisierung von freier Assoziation.
DR: Mit dem heißen Stuhl und dem leeren Stuhl ist er eigentlich wieder zum Setting der Couch mit dem Therapeuten dahinter zurückgekehrt.
LP: Im Ergebnis hielt er sich selbst heraus und gab nur noch bestimmte Hinweise oder Anordnungen. Das kam zum Teil auch durch seine mehrjährige Theatererfahrung bei Max Reinhardt in der Zeit vor seiner psychiatrischen Arbeit.
DR: Er arbeitete auch vor allem mit Projektion als Hauptinstrument der Behandlung.
LP: Mit relativ gesunden Menschen kann man das ja auch machen. Bloß mit wirklich richtig schwer kranken Menschen kann man nicht mit der Technik des leeren Stuhls arbeiten. Er hatte tatsächlich aufgehört, therapeutisch zu arbeiten. In den Gruppen hatte er nur Profis als Teilnehmer. Sie waren meist sogar fortgeschrittene Profis, arbeiteten schon mehrere Jahre in eigener Praxis oder hatten zumindest schon eigene Therapeuten oder Analytiker. Wenn er jemanden als unsicheren Kandidaten einschätzte, überging er ihn einfach. Fritz war ein Anreger, nicht ein Förderer. Er hatte wunderbare Eingebungen und Ideen, aber er besaß keine Geduld.
DR: Du hast die frühe Arbeit in New York erwähnt. Wer waren da die wichtigsten Leute?
LP: Für mich selber war Paul Goodman der wichtigste, denn er regte mich zu Wegen an, die ich noch nicht gegangen war.
DR: Kannst Du ein Beispiel sagen.
LP: Er war ein Renaissance-Mensch, einer der ganz wenigen "made in America". Hier haben die Leute normalerweise nicht die Bildung und den Hintergrund, dass sie Sprachen beherrschen und sich in Philosophie auskennen, eigene Denkwege einschlagen und in Kunst, Anthropologie und Musik mitreden können. Paul hatte das alles zusammen und in ein funktionierendes Leben integriert.
DR: Er entwickelte einiges davon, als er bei Dir in Therapie war.
LP: Er entwickelte einen anderen Stil. Er entwickelte Kommunikationsfähigkeiten, wohingegen er vor der Therapie härter, aggressiver und rebellischer war. Nach unserer Arbeit hatte er mehr Boden.
DR: Was war sein Beitrag für Dich?
LP: Die Therapie mit ihm entwickelte sich allmählich zu einer Art gegenseitiger Therapie. Und ich bekam von ihm in gleichem Maße zurück.
DR: Was?
LP: Vertrauen in mich selbst, größere Unabhängigkeit zu eigenem Denken.
DR: Wie hatte es sich angefühlt, sozusagen Frau Fritz Perls zu sein?
LP: Damit hatte ich mich jahrelang herumgeschlagen. Ich weiß noch, wie ich mal in Südafrika den Herausgeber einer Sonntagszeitung traf. Er wollte von mir ein Interview haben und schickte einen Redakteur und einen Fotografen vorbei. Die erste Frage von ihnen war: "Wie geht es einem, wenn man die Frau eines Psychoanalytikers ist?" Das konnte ich ihnen gar nicht wirklich sagen, denn ich bin selber Psychoanalytikerin. Sie haben dann ziemlich schnell ihre Sachen eingepackt und sind verschwunden. Mit Fritz verheiratet zu sein war hart. Nicht am Anfang, auch nicht über viele Jahre hinweg. Aber als wir hierher kamen, da wurde es schwierig. In Südafrika war es nicht schwierig, da brauchte er mich, denn er hatte für seine Arbeiten und Gedanken niemanden mit einem passenden Hintergrund. Später war das anders. Dann hatte er viele Leute, die ihn beeinflussten. In den späteren Jahren lebten wir auch die meiste Zeit getrennt. In Südafrika hatten wir ähnliche Hintergründe und arbeiteten unsere Gedanken gemeinsam aus. Er hatte niemand anders, mit dem er unsere Arbeit ernsthaft diskutieren konnte. Es gab dort nur wenige Leute dafür. Es gab ein paar Leute, die mit uns zusammen gelernt hatten und die belesen waren, aber sie hatten keine Erfahrung.
DR: Fritz hatte eine Ausbildung als Arzt.
LP: Nein, Fritz hatte keine ordentliche Ausbildung als Arzt. Er hatte eine Notausbildung der Kriegszeit. Er ging zum Militär, noch bevor er mit dem Studium fertig war. Und als er aus dem Krieg zurückkam, wurden alle Medizinstudenten rasch durch die letzten Kurse und Praktika durchgeschleust. Danach wendete er sich sofort der Psychoanalyse zu, ohne einen guten medizinischen Hintergrund zu haben.
DR: Und Dein eigener Hintergrund waren mehr die Philosophie und Psychologie?
LP: Ich beschäftigte mich sofort mit der Gestaltpsychologie. Die hatte mich von Jura und Wirtschaft weggelockt. Noch während des Jurastudiums ging ich in Vorlesungen von Gelb [Adéhmar Gelb, 1879-1936]. Er machte sehr gute Lehrveranstaltungen. Er war interessant. Er war belesen. Er hatte einen ganz anderen Horizont als die üblichen Psychologen. Später waren Max Wertheimer und Goldstein für mich noch eindrucksvoller. Gelb war ausgezeichnet in der Lehre und bei der Einführung in Gestalt, aber als Doktorvater war er sehr schwierig.
DR: Was führte Dich zur Psychoanalyse?
LP: Fritz. Ich beschäftigte mich mit Psychoanalyse, weil ich den Jargon verstehen wollte, den er und einer seiner Freunde die ganze Zeit drauf hatten. Ich wollte verstehen, worüber sie überhaupt sprachen. Sie analysierten wie wild jeden um sie herum, auch mich. Da wollte ich dabei sein.
DR: Wie gelang es Dir, dabei zu sein?
LP: Fritz war in Analyse bei Clara Happel [1889-1945], einer Freudianischen Analytikerin mit Ausbildung in Berlin. Und ich begab mich auch zu ihr in Analyse.
DR: Wie lange bliebst du bei ihr und wie war es?
LP: Ich war bei ihr nur sechs Monate oder ein bisschen länger. Dann zog sie nach Hamburg, und ich ging zu Karl Landauer [1887-1945], der damals *der* Analytiker war.
DR: Wie war Deine Erfahrung als Patient in Psychoanalyse?
LP: Ich war viel mehr von Landauer beeindruckt, der außerordentlich klug und im Spektrum der Psychoanalyse sehr liberal war. Er war mit Ferenzi und Groddeck eng befreundet, die damals schon am Rande standen, und tatsächlich eigenständiger und aktiver.
DR: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Rolle von Politik und Kunst. Welchen Einfluss hatten sie auf die Entstehung der Gestalttherapie?
LP: Wir engagierten uns damals sehr für linke Politik. In Südafrika taten das die meisten in unserem Freundeskreis ebenfalls. Manche waren sehr aktiv für die Vierte Internationale und fragten mich, warum ich mich nicht noch mehr engagierte. Ich antwortete ihnen: Wisst Ihr, meine Arbeit ist eine politische Arbeit. Wenn man Menschen an einen Punkt führen kann, an dem sie eigenständig zu denken anfangen und sich von vorherrschenden Meinungen frei machen können, dann ist das eine politische Arbeit mit Ausstrahlungen, selbst dann, wenn wir nur mit einer sehr begrenzten Anzahl von Menschen arbeiten können. Für unsere Arbeit wählen wir uns solche Leute aus, die ihrerseits wieder Einfluss auf andere haben. Das ist politische Arbeit.
DR: Du sprachst schon von Paul Goodman und dass Du Artikel von ihm in "Politics" gelesen hattest. Dwight McDonald [Herausgeber und Verleger von "Politics"] war Anarchist, und Paul ebenso.
LP: Gestalttherapie ist ein anarchistischer Prozess in dem Sinne, dass sie keinen vorgefertigten Formen und Regeln genügt. Sie will nicht den Menschen an ein bestimmtes System anpassen, sondern vielmehr an sein eigenes schöpferisches Potential.
DR: Du hast oft gesagt, Gestalttherapie ist keine Anpassungstherapie. Ich habe das so verstanden, wenn jeder Mensch den Weg dafür freimacht, dass sich seine eigenen Gestalten entwickeln, und dass sie dann...
LP: Er entwickelt sie aber nicht im luftleeren Raum. Er ist immer von etwas umgeben, was auch immer der Fall sein mag.
DR: Das Feld. Kontakt mit dem, was gerade da ist. Darin steckt aber schon ein unkonventioneller, nicht aufs Bewahren gerichteter Zugang zum Einzelnen und der Gesellschaft.
LP: Die konservative Haltung basiert weitgehend auf fixierten Gestalten. Ich denke an einen Vers von Goethe: "Es erben sich Gesetz' und Rechte wie eine ew'ge Krankheit fort ..." [deutsch im Original, Quelle: Faust I].
DR: Das musst Du mir aber übersetzen.
LP: [übersetzt nicht wort-wörtlich, aber sinngemäß, und fügt erst hier hinzu:]
wo Recht zu Unrecht wird und Unrecht Recht.
DR: Es ist also ein politischer Akt, Therapie zu machen.
LP: Jede Therapie, ja alles was man mit anderen Menschen in konzentrierter Verfassung tut, ist ein politischer Akt. Das geht schon los beim Unterricht, ja schon in der Familie bei der normalen, traditionellen Erziehung.
DR: In "Das Ich, der Hunger und die Aggression" und in manchen Gestalttherapien gibt es direkte Bezüge zum übergeordneten Gesellschaftssystem und zur umgebenden Kultur.
LP: Dass inzwischen eine Arbeitsweise vorherrscht, die sich ganz auf das Individuum konzentriert, liegt sehr am persönlichen Einfluss von Fritz, besonders seine Zeit an der Westküste und seine Ausdehnung der Arbeit über die ganze Welt. Das wurde damals natürlich gerne aufgegriffen, weil viele Menschen, und die jungen ganz besonders, von den gesellschaftlichen Verhältnissen ihrer Zeit sehr enttäuscht waren. Ein Teil von ihnen leistete Widerstand gegen den Krieg [in Vietnam].
DR: Was hältst du von der Auffassung, Gestalttherapie könne zu einem Introjekt werden?
LP: In meiner Arbeit versuche ich so gut ich kann, dem entgegenzuwirken. Gestalttherapie steht in der Gefahr, selber eine fixierte Gestalt zu werden, besonders hier [in Nordamerika].
DR: Für Dich hatte Literatur sicher eine große Bedeutung. Du hast auch selber Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Paul Goodman hat Theaterstücke, Romane, Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben.
LP: Ein Kunstwerk ist immer die Integration von Bestandteilen, die zuvor andersartig, unterschiedlich und teilweise unverträglich waren, zu einer neuen Ganzheit, in der sie nun einen sinnvollen Platz einnehmen. Das kann eine mathematische Formel sein oder ein Gedicht, eine Kurzgeschichte oder ein Tanz...
DR: Darf ich mal den Soziologen spielen? Nehmen wir mal den Hintergrund der Leute, die anfänglich bei der Entstehung der Gestalttherapie wichtig waren. Unter ihnen waren nicht viele Mathematiker und nicht viele Köche...
LP: Nein.
DR: Es waren mehr Künstler und Schriftsteller. Hier liegt mein persönliches Interesse, dem ich in diesem Interview noch mehr nachgehen möchte. Ich war immer sehr beeindruckt von Fritz' Hintergrund im Schauspiel und seinem Interesse an der Oper, von Pauls Interesse an Literatur, Drama und Schriftstellerei, von Deinem Interesse an Musik und Literatur. Und Ihr drei wart so entscheidend für die Entstehung der Gestalttherapie. Ihr kamt zwar nicht als Künstlergruppe zusammen, die dann therapeutische Techniken erfand, aber der Hintergrund im Künstlerischen war bei euch immer von großer Bedeutung.
LP: Therapie ist doch selbst eine Kunst. Sie ist viel mehr Kunst als Wissenschaft. Sie erfordert sehr viel Empfindsamkeit und Eingebung, und ihr Blick aufs Ganze birgt eine ganz andere Qualität als der atomistische Ansatz der Assoziationstechnik. Als Künstler geht man ganzheitlich vor. Und als guter Therapeut muss man das auch können.
DR: Würdest Du jetzt etwas über Paul Weisz sagen?
[Paul Weisz war eines der Gründungsmitglieder des New Yorker Gestaltinstituts, und er gehörte wie Laura, Fritz, Paul Goodman und Isadore From zu den ersten Trainern der Cleveland Gruppe, aus der die Gründung des Clevelander Gestaltinstituts hervorging. Paul Weisz hatte innerhalb dieser Gruppe das größte Interesse an Zen. Auf ihn geht zurück, dass östliche Philosophien in die Gestalttherapie Eingang fanden.]
LP: Paul Weisz war ein Europäer.
DR: Und damit meinst Du...
LP: Ich meine damit, dass er einen ähnlichen Bildungshintergrund hatte. Eine humanistische Bildung. Die Fritz an sich auch hatte, aber nicht so zur Geltung kommen ließ. Seine Schulen waren nicht so gut wie meine, er hatte keine Achtung vor den Lehrern, er war gelangweilt. Er blieb dreimal in derselben Klasse sitzen, was wirklich eine Höchstleistung an Trotz darstellt.
DR: Wann war er sitzen geblieben?
LP: Mit fünfzehn, sechzehn oder so. Ich glaube, im Alter zwischen dreizehn und sechzehn war er ziemlich festgefahren.
DR: Auf dem Höhepunkt der Pubertät.
LP: Sie nahmen ihn von der Schule und steckten ihn in ein Geschäft, aber das war noch schlimmer. Darauf suchte er sich eine andere Schule, und die absolvierte er mit fliegenden Fahnen.
DR: OK. Du sprachst zuletzt über Paul Weisz und was es heißt, Europäer zu sein.
LP: Ich meine damit, einen viel breiteren und fundierteren Hintergrund in Sprachen und allem zu haben. In all dem, was man heute hier mit Glück erst in einem College finden kann, also erst dann, wenn sich die meisten mit Mädchen, Autos und Lebensplänen beschäftigen. Bei uns kamen Sprachen mit neun oder zehn auf den Lehrplan, wir begannen mit Latein und Griechisch und hatten außerdem Naturwissenschaften, Mathematik und Geschichte. Nicht nur Geschichte Deutschlands. Was ich von der Schule mitbekam, war eine Grundlage, von der aus ich überall hingehen konnte, wohin ich wollte. Und ich konnte mich in die unterschiedlichsten Gebiete einlesen.
DR: Du hast schon Tillich und Buber genannt.
LP: Tillich und Buber waren viel mehr, als was man üblicherweise von Theologen erwarten kann. Sie waren richtige Psychologen.
DR: Was ist der Unterschied?
LP: Sie interessierten sich für Menschen, sie redeten nicht über Dinge. Wenn man Tillich oder Buber zuhörte, spürte man, sie redeten direkt zu Dir und nicht einfach über irgendetwas. Diese Art der Kontaktaufnahme war auch ein zentraler Punkt in ihren Theorien.
DR: Würdest Du etwas sagen über den Unterschied zwischen Deutschland, Südafrika, New York und Kalifornien?
LP: Als ich nach New York kam, fand ich nicht die Zeit zu spüren, wie es dort ist und was dort anders ist. Wirklich. Ich musste mich schnellstens einleben. Ich musste als erstes meine Kinder eingewöhnen, Schulplätze für sie finden und eine Wohnung für uns besorgen. Ich fing auch sofort mit der Praxis an. Schon gleich als wir ankamen, wollte Fritz uns alles zeigen, ging mit uns zum Times Square und führte uns zu Gimbels und Macy's. Es war einfach nur beängstigend. Fritz hatte bereits einige Künstler kennen gelernt und auch schon begonnen, zusammen mit Paul zu schreiben. Über Paul lernten wir Paul McDonald kennen [gemeint ist vermutlich Dwight McDonald, berühmter Kritiker und in den vierziger und fünfziger Jahren Herausgeber der Zeitschrift "Politics"]. Ich gelangte sofort in Kreise, in denen ich mich wie zu Hause fühlte.
DR: Wenn Du das Berlin der dreißiger Jahre und das New York der späten vierziger und der fünfziger Jahre vergleichst, was war dann ähnlich, was war verschieden?
LP: Vieles war sehr anders. In Berlin war man schon stets auf der Hut. Aber hier habe ich niemals dieses Gefühl bekommen. Irgendwie war der hiesige Elfenbeinturm viel geschützter.
DR: Noch weitere Unterschiede?
LP: Ich bin auf viele Unterschiede getroffen, was den Umgang mit mir als intellektueller Frau betrifft. Eigentlich galt ich überall - in Südafrika, in Deutschland und hier - als einer von den Jungs. Aber in Deutschland und in Europa überhaupt gibt es doch viel mehr Etiquette. Dort vergaßen die Jungs nicht, dass ich ja auch noch eine Frau bin. Hierzulande vergaßen sie es irgendwie. Ich weiß noch, wie ich mal mit Paul Goodman auf einer Party war, irgendwo auf der Neunten Avenue in einem düsteren, heruntergekommenen Viertel. Um ein Uhr morgens wollte ich gehen. Er sagte: "OK, ich geh mit Dir zum Bus". Wir gingen gemeinsam vermutlich auf die Achte Avenue und warteten dort eine Weile. Dann kam ein Bus in die Gegenrichtung zu dem Ziel, wo ich hin wollte. Da sagte Paul: "Oh, da ist ja mein Bus", und war auf und davon. Und ich blieb allein zurück um ein Uhr früh in diesem Viertel. So was wäre in Deutschland nicht vorgekommen. Aber er hatte einfach nicht daran gedacht, dass ich ja eine Frau bin, die möglicherweise Schutz braucht.
DR: Was hat die Entwicklung der Gestalttherapie sonst noch beeinflusst?
LP: Wir haben viel von den östlichen Philosophien und ihrem ganzheitlichen Ansatz gelernt.
DR: "Östliche Philosophien", was meinst du damit genauer?
LP: Buddhismus und Übersetzungen von östlicher Literatur. Als ich noch ein Mädchen war, hielt überall ein indischer Dichter Lesungen ab, und wir lasen seine Werke. Damals schrieb auch Hermann Hesse, wir lasen seine Bücher frisch aus der Druckerei. Später las ich "Zen und die Kunst des Bogenschießens". Aus dem Osten kamen auch die Übungen für den Modern Dance [Ausdruckstanz]. Dessen Bewegungen gründen viel mehr in östlichen Einstellungen als in dem, was im Westen entwickelt wurde, etwa im Ballett. Damit wird überhaupt nichts anderes unterstützt, sondern es ist ähnlich wie Koloratursingen und kann einfach in sich selbst sehr schön sein.
DR: Würdest Du sagen, dein Gebrauch des Körpers oder des Atems...
LP: Es ist nicht der Gebrauch der Körpers. Das wäre wieder eine aufspaltende Sichtweise: "Hier oben bist du in deinem Kopf und da unten bist du in deinem Körper". Der Punkt ist vielmehr, der Körper zu sein. Das erkläre ich in jedem meiner Kurse und in jeder Gruppe: Wenn Du ein Körper bist, wenn Du Dich selber völlig als der Körper erlebst, dann bist Du jemand leibhaftig ("somebody"). Die [englische] Sprache bringt das plastisch zum Ausdruck. Wenn Du das nicht tust, dann empfindest Du Dich leicht als niemand ("nobody").
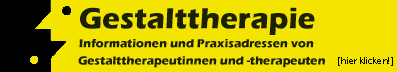

Laura Perls (1905 - 1990) Mitbegründerin der Gestalttherapie - gemeinsam mit ihrem Ehemann Fritz Perls und dem amerikanischen Sozialpsychologen und Schriftsteller Paul Goodman.
Das nebenstehende Gespräch führte der amerikanische Gestalttherapeut Daniel Rosenblatt mit Laura Perls. Er war einer der ersten Klienten von Laura Perls und später ein ihr naher Kollege und Vertrauter.
Dieses Interview wurde 1984 auf Videoband mitgeschnitten und anschließend von Joe Wysong für die Veröffentlichung überarbeitet. Es erschien erstmals gedruckt im Frühjahr 1991 in The Gestalt Journal, Band XIV, Nummer 1 und wurde im selben Jahr aufgenommen in "Living at the Boundary: The Collected Works of Laura Perls" (The Gestalt Journal Press, Highland, New York).
© 1991 by The Gestalt Journal Press. Wir danken Joe Wysong und dem Verlag für die freundliche Genehmigung der deutschen Erstübersetzung.
Aus dem Amerikanischen von Thomas Bliesener.

