


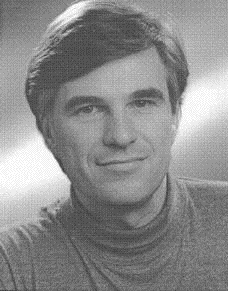 Frank-M. Staemmler
Frank-M. StaemmlerFrank-M. Staemmler:
KULTIVIERTE UNSICHERHEIT
Gedanken zu einer gestalttherapeutischen Haltung
Innerhalb therapeutischer Beziehungen wird die Deutungsmacht von TherapeutInnen immer wieder zu ihren Gunsten monopolisiert; die Anwendung konventioneller diagnostischer Methoden und Modelle ist hierfür ein Beispiel. Das steht für mich im Widerspruch zum dialogischen Vorgehen in der Gestalttherapie. Der berechtigte Wunsch der TherapeutInnen, eine klare Orientierung für und Sicherheit in ihrer Arbeit zu finden, muß ernstgenommen und nach Möglichkeit befriedigt werden. Die konventionelle Diagnostik liefert aber nach meiner Meinung nur eine Scheinsicherheit, denn sie erkauft sich diese durch die Konstruktion eines stereotypisierenden,systematisch reduzierten und dadurch verfälschten Bildes von den KlientInnen. Es scheint mir darum nötig, nach einem neuen Weg zu suchen, der den Bedürfnissen von KlientInnen und TherapeutInnen in der Gestalttherapie besser entspricht. Ich plädiere für eine Haltung der TherapeutInnen, die ich als "kultivierte Unsicherheit" bezeichne, und verweise auf verschiedene Ansätze und Methoden der Gestalttherapie, die dieser Haltung entsprechen.
Als ich mich im April 1993 zum internationalen Gestalttherapie-Kongreß aus Anlaß des 100. Geburtstags von Fritz Perls in Montreal aufhielt, besuchte ich eine Ausstellung im Nationalmuseum. Ich ahnte nicht, daß ich dort einem Thema wiederbegegnen würde, mit dem ich mich in ganz anderem Zusammenhang während der letzten Jahre viel beschäftigt habe. Denn die Ausstellung befaßte sich mit der im Laufe der Zeit immer wieder gewandelten Identität der kanadischen Indianer, wie sie sich seit der europäischen Besiedlung (oder sollte man besser sagen: Besetzung?) Nordamerikas im Spiegel verschiedener von Weißen geschaffenen Dokumente darstellt: Die weithin bekannten Klischees vom "edlen Wilden" oder der "Bestie in Menschengestalt" möchte ich als Beispiele nennen; sie sind aber nicht die einzigen, sondern nur die wohl am weitesten verbreiteten Definitionen indianischer Identität durch Europäer.
Die vielfältigen Exponate dieser Ausstellung unter dem Titel "Fluffsand Feathers" ("Flaum und Federn") - z.B. Plakate, Bücher, Fotos,Filmausschnitte - waren jeweils mit Texttafeln versehen, auf denen der ausgestellte Gegenstand erläutert und kommentiert wurde. Zwei Passagen daraus möchte ich meinem folgenden Text voranstellen:
"Die Stereotypisierung einer Gruppe von Menschen durch eine andere ist ein Akt der Ausübung von Macht und Kontrolle. Stereotypisierung findet statt, wenn eine Gruppe in Verfolgung eigener Absichten andere Menschen zu definieren versucht und, indem sie dies tut, ihnen Grenzen und Beschränkungen auferlegt." - "Es ist nicht richtig, einen anderen Menschen zu definieren und ihm zu sagen, wer er sei und wo er einzuordnen sei. Man kann das nicht mit jemandem machen, den man als seinesgleichen betrachtet. Man kann nicht Kontrolle über eine andere Person oder eine andere Gruppe von Menschen ausüben, es sei denn, man versteht sie als untergeordnet und sich selbst als übergeordnet."
Was diese Sätze für den Umgang von Völkern miteinander thematisieren, läßt sich, wie ich meine, auch für den gegenseitigen Umgang von Individuen behaupten. Das gilt in besonderem Maße dann, wenn die beteiligten Personen sich im Rahmen von Beziehungen begegnen, in denen - zumindest potentiell - ein Machtgefälle herrscht. Therapeutische Beziehungen müssen sicher dazugerechnet werden.
Machtausübung von TherapeutInnen gegenüber ihren KlientInnen findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt und kann viele verschiedene Formen annehmen. Ohne die Möglichkeit zur Einflußnahme wäre therapeutische Effektivität nicht denkbar, in ihr liegt darum notwendigerweise auch die Gefahr schädlicher Auswirkungen für die KlientInnen. Diesen vorzubeugen ist jedoch nicht nur Aufgabe der TherapeutInnen, die die Formen ihrer Machtausübung immer wieder zu reflektieren und zu überprüfen haben. Schädigungen zu verhindern ist immer auch Aufgabe der potentiell Betroffenen, also der KlientInnen, denn was mit ihnen gemacht wird, ist immer auch das, was sie mit sich machen lassen.
Mit dem vorliegenden Text will ich darum nicht nur meine KollegInnen zum Nachdenken über bestimmte Formen ihrer Einflußnahme auf KlientInnen anregen. Obwohl ich aus der Perspektive des Therapeuten schreibe und primär TherapeutInnen anspreche, habe ich durchaus auch jene Menschen im Auge, die als KlientInnen Psychotherapie in Anspruch nehmen oder in Erwägung ziehen, dies in Zukunft zu tun. Ich würde mich freuen, wenn der folgende Text ihnen ein Kriterium an die Hand geben würde, das ihnen hilft zu beurteilen, ob das Vorgehen einer Therapeutin oder eines Therapeuten ihren Interessen entspricht.
" Ich bin nur zum Telefonieren gekommen."
Ich möchte zunächst ein Geschichte zusammengefaßt wiedergeben,deren vollständige Lektüre im Originaltext ich wegen ihrer gedanklichen Klarheit sowie ihrer sprachlichen und literarischen Qualität jeder Leserin und jedem Leser empfehle: Der Literatur-Nobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez schildert in einer seiner "Zwölf Geschichten aus der Fremde" (1993, S. 97ff.) die Erlebnisse einer Frau, deren Auto auf der Landstraße wegen einer Panne liegenbleibt und die versucht, bei strömendem Regen als Anhalterin das nächste Telefon zu erreichen. Sie wird schließlich von dem Fahrer eines Kleinbusses mitgenommen, in dessen Fahrzeug sich eine Gruppe schlafender, in Decken gehüllter Passagiere befindet.Auch sie bekommt, naß und unterkühlt wie sie ist, eine Decke.
Als der Bus an seinem Ziel angelangt ist, steigt sie mit den anderen Fahrgästen aus und betritt ein Gebäude, in dem uniformierte Frauen ihr auf die Frage nach einem Telefon antworten, sie möge zunächst mit den anderen in den Schlafsaal gehen und ihr Bett belegen. Ihre Erklärungen, Proteste und Fluchtversuche werden mit mehr oder weniger sanfter Gewalt beantwortet und bleiben erfolglos.
Am nächsten Tag wird sie dem ärztlichen Leiter des Hauses vorgestellt, das sich inzwischen als psychiatrische Anstalt entpuppt hat. Dieser geht ausgesprochen freundlich und geduldig mit ihr um. Auf ihre Mitteilung, sie sei nur zum Telefonieren gekommen, und den wiederholt zum Ausdruck gebrachten Wunsch, doch endlich ihren Mann anrufen und von ihrem Verbleib unterrichten zu dürfen, reagiert der Chefarzt mit dem in väterlichem Tonfall gesprochenen Satz: "Alles kommt zu seiner Zeit" - und beendet das Gespräch.
Nach einigen Wochen gelingt es ihr, ihrem Mann eine Nachricht zukommen zu lassen. Als Preis dafür muß sie den sexuellen Anträgen einer Nachtschwester nachgeben. Der Besuch ihres Mannes in der Anstalt, von dem sie sich ihre Befreiung ersehnt, beginnt mit einem Gespräch, in dessen Verlauf der Anstaltsleiter ihm die psychische Krankheit seiner Frau erläutert. Dabei ist von Erregungszuständen, vehementen Aggressionen und fixen Ideen (insbesondere der, telefonieren zu wollen) die Rede. Eine weitere Behandlung sowie die verständnisvolle Kooperation des Ehemannes im Interesse eines positiven Krankheitsverlaufs seien unbedingt erforderlich.
Als er seiner Frau dann begegnet, tröstet er sie liebevoll, sagt ihr, daß sicher bald alles besser werde, und verspricht ihr, sie regelmäßig zu besuchen. Sie ist zunächst fassungslos; dann fängt sie an zu toben und zu schreien wie eine Irre. Bei dem nächsten Besuch ihres Mannes weigert sie sich, mit ihm zu sprechen. Der Chefarzt beruhigt ihn: "Das ist eine typische Reaktion, das geht vorüber."
Bedürfnis nach Sicherheit
Ich will erst einmal nicht weiter auf diese Geschichte eingehen; sie spricht für sich. Ich möchte ihr vielmehr zunächst eine Art "Gegenthese" gegenüberstellen:
Ich denke, wir TherapeutInnen haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit bei unserer Arbeit. Wir wollen uns subjektiv sicher fühlen in dem, was wir tun. Das ist ein legitimes Bedürfnis, ja es ist ein Grundbedürfnis von Menschen überhaupt, wenn man an die Maslow'sche Bedürfnishierarchie denkt (vgl. Maslow, 1981). Aber es ist auch ein spezielles Bedürfnis, das wir in unserer Arbeit haben. Denn wenn wir bei der Ausübung unseres Berufes den ganzen Tag lang unsicher wären, wären wir abends fix und fertig und kämen völlig erledigt nach Hause.
Wir haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit aber keineswegs nur aus psychohygienischen Gründen. Es ist außerdem wichtig in bezug auf unsere Arbeit: Wir brauchen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, bestimmte Maßstäbe und Orientierungshilfen. Wir bekommen von jeder Klientin und jedem Klienten in jeder einzelnen Sitzung immer wieder eine Fülle von verbalem und nonverbalem "Material" geliefert. Wir wären völlig überflutet von all den Reizen, die ständig auf uns einströmen, wenn wir keine Kriterien hätten, nach denen wir entscheiden können, was wir zum jeweils gegebenen Zeitpunkt für wichtig und was wir für nebensächlich halten. Zwar gibt es von einer therapeutischen Schule zur anderen und sicher auch von TherapeutIn zu TherapeutIn unterschiedliche Kriterien, aber sie alle erfüllen den gleichen Zweck. Sie sollen uns Sicherheit zu geben, damit wir nicht fassungslos von der Unmenge an Informationen stehen und nicht mehr wissen, worauf wir uns beziehen sollen.
Das hat auch eine wichtige positive Rückwirkung auf unsere KlientInnen. Indem wir eine gewisse Sortierung und/oder Gewichtung der Informationen vornehmen, z.B. wenn wir zu einer oder einem unserer KlientInnen sagen, "Das scheint mir ein wichtiger Punkt zusein", geben wir ihr oder ihm die Gelegenheit, sich an etwas zu reiben, sich mit etwas auseinandersetzen und es für sich zu überprüfen. Er/sie kann sich fragen, was daran für ihn/sie stimmig ist,was vielleicht eine "heiße Spur" zu sein verspricht oder was sie/er nicht weiter verfolgen will. Und damit haben auch die KlientInnen für sich eine Orientierung gefunden.
Ich will noch einen weiteren Grund dafür aufführen, warum derWunsch von uns TherapeutInnen nach Sicherheit auch für unsere KlientInnen nützlich ist. Wenn wir ihnen nämlich mit einer einigermaßen großen Sicherheit gegenübertreten, haben wir für sie auch eine gewisse Überzeugungskraft. Man weiß ja aus der vergleichenden Psychotherapieforschung, daß die sogenannte "persuasive potency" der TherapeutInnen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von Therapien liefert. Wenn TherapeutInnen den stimmigen Eindruck hinterlassen, daß sie von dem überzeugt sind, was sie machen, dann hat das auf ihre KlientInnen eine heilsame Wirkung,die unabhängig von der angewandten therapeutischen Methode ist.
Diagnostik und Sicherheit
Wenn nun die Sicherheit von uns TherapeutInnen mit ihrer wohltuenden Wirkung für uns selbst sowie für unsere KlientInnen, wie oben erwähnt, zu einem großen Teil daraus erwächst, daß wir die Informationen in der therapeutischen Situation auf irgendeine Weise ordnen, dann ist das gleichbedeutend mit der Aussage: Die Sicherheit von TherapeutInnen ergibt sich u. a. aus einem diagnostischen Vorgang. Wir ordnen, indem wir zuordnen, Ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen, Zusammenhänge herstellen und Gewichtungen vornehmen. Wir bilden Begriffe und Kategorien, die uns ermöglichen, einzelne Informationen zu sortieren, und so reduzieren wir die ohne einen solchen Vorgang unüberschaubare Menge an Informationen.
Das subjektive Gefühl von Sicherheit entsteht aus dem Eindruck zu wissen, womit man es zu tun hat, was was ist, zu welcher Gruppe von Phänomenen etwas gehört. Wenn ich z.B. den Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze, nicht sofort als "Stuhl" identifizieren würde, obwohl er ganz anders aussieht als meiner zu Hause, würde es für mich ziemlich mühsam und umständlich, mich in meiner Umgebung zurechtzufinden. Da ich ihn - wie viele andere Dinge und Ereignisse - aber einer bestimmten Kategorie zuordnen kann, läßt sich das Leben mit einer gewissen Effizienz und Sicherheit bewältigen.
Diesem Prinzip folgt auch jede Art von psychologischer Diagnostik, gleichgültig welchem theoretischen Ansatz sie verpflichtet ist. Sie liefert (mehr oder weniger genaue) Kriterien für die Anworten auf die Fragen "Was ist das Problem?" und, in der Konsquenz, "Was ist bei einem solchen Problem zu tun?"
Die Bedeutung von Bedeutungen
Was sich zunächst erst einmal einfach anhört, erweist sich bei genauerem Hinschauen aber als etwas diffiziler. Denn es geht in der Psychotherapie ja meistens nicht einfach um meßbare Daten und um äußere Ereignisse, sondern darum, welche Bedeutungen die Ereignisse für die beteiligten Menschen haben. Ich will das an einem "klassischen" Beispiel deutlich machen: Wenn ein Klient sich an seine Mutter erinnert, dann kann das für ihn die Bedeutung haben, daß er sich noch heute durch sie kontrolliert, dominiert oder drangsaliert fühlt. Oder es kann für ihn die Bedeutung der Erinnerung an eine nette alte Frau haben, mit der er sich gelegentlich gerne unterhält. Nicht die Tatsache, daß er eine Mutter hatte, auch nicht die Tatsache, daß diese ihn vielleicht früher kontrolliert und drangsaliert hat, sondern die Tatsache, daß er diesen Ereignissen noch heute die Bedeutung einer Einschränkung für sich gibt, läßt sie heute in seiner Therapie relevant werden. Wenn sie heute für ihn kein Problem mehr darstellen, muß er sich auch heute in seiner Therapie nicht mehr damit beschäftigen. Also nicht primär die Fakten, sondern hauptsächlich die Bedeutungen, die jemand ihnen gibt, sind in der Therapie maßgebend.
Damit sind wir mitten in der Problematik von Diagnostik in der Psychotherapie: Wir haben schon festgestellt, daß Diagnosen Kategorisierungen sind, aus denen Handlungsmaßstäbe folgen. Nun kommt noch die Tatsache hinzu, daß sich diese auf Bedeutungen von Verhalten und Erleben beziehen, nicht auf Verhalten oder Erleben "an sich" (wenn es so etwas überhaupt gäbe). Die Bedeutung, die vergeben wird, entscheidet über die Zuordnung zur diagnostischen Kategorie. Das gröbste Raster ist hier die Dichotomie "gesund/krank", nach der einem Verhalten die Bedeutung von etwas Normalem oder aber Pathologischem gegeben wird.
Erinnern wir uns an die Frau aus der Erzählung von Marquez. Sie will telefonieren. Für sie hat dieser Wunsch die Bedeutung einer gesunden, verantwortlichen Handlung im Rahmen der Beziehung zu ihrem Mann, den sie von ihrer Verspätung informieren will, damit dieser nicht vergeblich auf sie wartet. Für das Klinikpersonal hat ihr Wunsch die Bedeutung einer krankhaften Zwangsvorstellung, einer fixen Idee, und diese Bedeutung bestimmt die Diagnose und damit auch die Reaktion, die dann erfolgt. Nicht der Wunsch der Frau zu telefonieren ist hier für die Diagnose einer Psychose ausschlaggebend, sondern die pathologische Bedeutung, die ihm zugeordnet wird.
Deutungsmacht und ihre Verteilung
Wenn es also um Bedeutungen geht, dann ist die Machtfrage in der Psychotherapie u.a. die Frage danach, wer die Macht hat, Bedeutungen zu vergeben. Es ist die Frage: Wer hat gegebenenfalls die Macht, seine Deutung gegen die des anderen durchzusetzen?
Deutungsmacht gibt es in jeder Form von Psychotherapie. Es gibt prinzipiell die Möglichkeit aller Beteiligten, Bedeutungen festzulegen und zuzuordnen. Nehmen wir einmal die bekannte Definition von Max Weber zuhilfe: "Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht" (1985, S. 28). Wenn wir diese Definition spezifizieren und auf den Zusammenhang von Psychotherapie und die Vergabe von Bedeutungen anwenden, dann heißt das: Jemand besitzt dann Deutungsmacht, wenn er eine Chance hat, die Bedeutung, die er einem Verhalten zuschreibt, innerhalb der therapeutischen Beziehung notfalls auch gegen das Widerstreben des anderen durchzusetzen.
Schauen wir uns nun einmal kurz an, wie in der konventionellen Form von psychologischer Diagnostik die Deutungsmacht verteilt ist. Da sind die diagnostizierenden TherapeutInnen, die sich die Informationen von ihren KlientInnen (manchmal auch von Dritten über die KlientInnen) geben lassen, eine Anamnese erheben, Verhaltensbeobachtungen anstellen, alle so gewonnenen Informationen durch die ihrer jeweiligen Theorie entsprechenden kognitiven Raster filtern, die Daten sortieren und gewichten, sie in Beziehung zueinander setzen und schließlich ihre Diagnose formulieren. Es ist offensichtlich: Die Deutungsmacht ist sehr einseitig verteilt; sie wird von den TherapeutInnen mehr oder weniger vollständig für sich beansprucht. - Ich möchte außerdem an die eingangs zitierten Bemerkungen über die kanadischen Indianer erinnern und darauf hinweisen, daß die konventionelle Diagnostik sich sehr stark stereotypisierender Kategorien bedient (vgl. Staemmler, 1989)
Scheinsicherheit
Betrachtet man diese Tatsachen einmal nicht aus einer ethischen, sondern mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dann ist festzustellen: Derjenige, der eine einseitig verteilte Deutungsmacht ausübt, verschafft sich ein Gefühl von Sicherheit, das sich bei genauer Betrachtung als Scheinsicherheit erweist. Denn innerhalb dieses Systems gibt es keine Möglichkeit der Überprüfung der gewonnenen Sicherheit. Die einseitige Verteilung von Deutungsmacht führt zu absolutistischen Verhältnissen, in denen einer allein festlegt, was wie zu gelten hat. Es gibt keine Instanz, die die Autorität hätte, die vergebenen Bedeutungen infrage zu stellen (oder auch zu bestätigen), weil keiner anderen Instanz die entsprechende Kompetenz zugebilligt wird. Die KlientInnen, die potentiell diese Instanz darstellen könnten, verstehen als Durchschnittsbürger ja meist noch nicht einmal die Terminologie, die im konventionellen Diagnosemodell verwendet wird. Noch weniger wissen sie in der Regel über die theoretischen Implikationen, die in die diagnostischen Kategorien einfließen. Oft werden den Betroffenen die Diagnosen noch nicht einmal mitgeteilt; das Resultat der einseitig ausgeübten Deutungsmacht wird bisweilen sogar aktiv vor ihnen verheimlicht. (Die Verheimlichung von Machtausübung ist übrigens von jeher eine beliebte Methode, Machtausübung durch ihre Verschleierung zu konsolidieren.)
Man muß sich also darüber klar sein: Wenn die Deutungsmacht einseitig verteilt ist, kann sie auf Seite der TherapeutInnen zu einem Gefühl von Sicherheit führen, das sich - von einem übergeordneten Gesichtpunkt - als pure Scheinsicherheit, als Illusion, entlarven läßt. An der Erzählung von Marquez wird das sehr deutlich. Für die LeserInnen als Außenstehenden ist es offensichtlich,daß das gesamte Klinikpersonal, in seiner Bandbreite vom freundlichen, sensiblen Chefarzt bis zur brutal vorgehenden Krankenschwester, sich völlig sicher darin fühlt, wie es das Verhalten der betroffenen Frau zu deuten hat. Und es gibt keine Instanz, die die Deutung in Frage stellen könnte, weil die einzige Instanz, die dazu in der Lage wäre, nämlich die "Patientin" selbst, mit ihrer Sicht der Dinge nicht ernstgenommen wird. Ihr wird keinerlei Deutungsmacht eingeräumt. Dadurch wird die Durchsetzung dessen, was dem Leser als Fehldiagnose auffällt, überhaupt erst möglich. Die subjektive Sicherheit des Personals bleibt unangetastet. Selbst bei einer positiven, zur Entlassung der "Patientin" führenden Diagnose, wäre dies der Fall, wenn natürlich auch ohne die tragischen Konsequenzen.
Fassen wir zwischendurch einmal kurz zusammen: Die Sicherheit von TherapeutInnen, die sich aus einer einseitigen Verteilung von Deutungsmacht ergibt, ist prinzipiell nicht irritierbar und daher immer eine Scheinsicherheit - auch dann, wenn sich die vergebene Bedeutung von einem übergeordneten Blickwinkel als 'richtig' erweisen sollte.
Diese Feststellung gilt natürlich nicht nur für den Bereich psychiatrischer Kliniken, aus dem das erwähnte Beispiel stammt, sondern genauso für den Bereich privater psychotherapeutischer Praxen,auch denen von GestalttherapeutInnen, wenn diese dem konventionellen diagnostischen Modell folgen. Wie allgemein bekannt ist, gibt es ja leider auch innerhalb der Gestalttherapie VertreterInnen dieses Modells.
Ein Beispiel, in dem eine Bedeutung von einer Gestalttherapeutin in der beschriebenen Art einseitig vergeben wurde, habe ich kürzlich mit Erschrecken selbst erlebt. Es handelte sich zwar in diesem Falle nicht um die Zuschreibung einer Diagnose im engeren Sinne, aber doch um einen vergleichbaren Vorgang, dessen Erwähnung für mich an diese Stelle paßt:
Während eines Kongresses hielten Werner Bock und ich ein Supervisions-Seminar ab, bei dem wir den teilnehmenden TherapeutInnen die Möglichkeit gaben, nicht nur miteinander, sondern auch mit KlientInnen aus ihrer alltäglichen Praxis unter unserer Supervisionzu arbeiten. Eine der anwesenden TherapeutInnen nutzte diese Gelegenheit und fragte eine ihrer KlientInnen, ob sie Interesse habe und bereit sei, eine Therapiesitzung im Rahmen unseres Seminars durchzuführen. Die Klientin, die sich selbst in gestalttherapeutischer Ausbildung befand, sagte zu, weil sie erwartete, sowohl als Klientin als auch als Ausbildungsteilnehmerin von der Supervision profitieren zu können. (Die dann während unseres Seminars stattfindende Sitzung mit ihrer Therapeutin unterstützte sie in der Tat, eine für sie wichtige und ihr bisheriges Leben stark bestimmende Thematik in Angriff zu nehmen.)
Eine außenstehende Kollegin, die nicht an unserem Seminar teilnahm, erfuhr von diesem Vorgang und kritisierte uns in einem Gespräch dafür, daß wir die Klientin "mißbraucht" hätten. Diese stehe doch wie alle KlientInnen in einer Abhängigkeitsbeziehung zu ihrer Therapeutin und sei daher nicht frei, die Einladung zur supervidierten Sitzung in unserem Seminar gegebenenfalls auch abzulehnen. Wir hielten ihr entgegen, daß wir von unseren eigenen KlientInnen immer wieder einmal ein Nein zu unseren Vorschlägen oder Anregungen zu hören bekommen und daß wir auch in diesem speziellen Fall den Eindruck gehabt hätten, die Klientin habe sich nicht einem Druck gebeugt, sondern frei entschieden. Wir hatten ihr jedenfalls deutlich gemacht, daß wir ihre Entscheidung in jedem Fall respektieren würden. (Auch auf spätere erneute Rückfrage bekräftigte die Klientin die Freiwilligkeit und Richtigkeit ihres Entschlusses.)
Die Kollegin ließ unseren Einwand nicht gelten. Sie behauptete wörtlich, es sei "ganz egal", was die Klientin selbst dazu sage. Sie sei in ihrer Übertragung gefangen und könne sich prinzipiell nicht frei entscheiden. Darum müsse sie - gegebenenfalls auch gegen ihren erklärten Willen (!) - vor einem Mißbrauch geschützt werden.
Die Rosenhan-Studie
Ich möchte nun auf eine Untersuchung hinweisen, die nach ihrer Veröffentlichung 1973 recht viel Wirbel ausgelöst hat. Ihre Ergebnisse gelten heute als ziemlich gesichert, wie ihre Aufnahme in das renommierte Lehrbuch der Klinischen Psychologie von Davison und Neale zeigt. Die Untersuchung von Rosenhan belegt, daß die negativen Konsequenzen der einseitigen Verteilung von Deutungsmacht nicht nur Fiktion sind wie in der Erzählung von Marquez, sondern eine handfeste Realität innerhalb unseres Gesundheitswesens darstellen.
"Eine neuere Untersuchung von Rosenhan (1973) illustriert auf dramatische Weise die Art von Irrtümern, die bei der Arbeit mit dem Diagnostic and Statistical Manual begangen werden können. In einem Zeitraum von drei Jahren veranlaßte Rosenhan die Einweisung einer Anzahl gesunder Leute in verschiedene, über die Vereinigten Staaten verteilte psychiatrische Kliniken. Es wurde sorgfältig darauf geachtet, daß keiner der Teilnehmer psychiatrische Probleme oder andere Funktionsstörungen hatte. Jeder dieser Pseudo-Patienten klagte bei der Aufnahme darüber, daß er Stimmen höre, die ,leer', ,hohl' und ,bums' sagten.
Dies war jedoch das einzige Symptom, das sie vortäuschten; es wurde von Rosenhan deshalb ausgewählt, weil es in der klinischen Literatur nirgends beschrieben wird. Rosenhan wollte sich deshalb auf dieses Symptom beschränken, weil die Diagnose einer Schizophrenie eigentlich auf der Grundlage von Störungen des Denkens und Fühlens sowie von zurückgezogenem oder bizarren Verhalten gestellt wird und nicht allein auf der Grundlage einer Halluzination. Darüber hinaus machte jeder Pseudo-Patient zutreffende Angaben über seine Familiengeschichte und seine gegenwärtigen Lebensbedingungen ...
Alle Pseudo-Patienten wurden als psychotisch diagnostiziert; in elf Fällen lautete die Diagnose ,Schizophrenie' und in einem Fall ,manisch-depressive Psychose'. Alle wurden in die Klinik aufgenommen, wo sie durchschnittlich neunzehn Tagen blieben. In keinem Fall entdeckte irgendeines der Personalmitglieder, daß der Pseudo-Patient tatsächlich völlig gesund war, und das, obwohl er unmittelbar, nachdem die Aufnahme gesichert war, aufhörte, über die vorgeblichen Halluzinationen zu sprechen, und sich wie gewöhnlich verhielt. (...) Wenn die Pseudo-Patienten entlarvt wurden, dann von echten Patienten. (...)
Rosenhan weist auf die Tendenz derjenigen hin, die innerhalb eines Krankheitsmodells denken, nahezu jedes Verhalten so zu interpretieren, daß eine Krankheit dahinter vermutet wird. Aber die einzige Grundlage dafür, das Verhalten der ,Patienten' als abnorm darzustellen, war die Tatsache, daß sie sich in einer psychiatrischen Station befanden und als ,psychotisch' diagnostiziert waren. Ihr tatsächliches Verhalten war völlig unauffällig. Rosenhan leitet daraus ab, daß psychiatrische Diagnosen wenig oder gar nichts mit dem tatsächlichen Verhalten des Patienten zu tun haben" (Davison u. Neale, 1979, S. 60 - alle Hervorhebungen dort; vgl. auch Rosenhan, in: Watzlawick, 1985, S. 111-137).
Kontext und Bedeutung
Die letzten Sätze des vorangegangenen Zitats weisen darauf hin, wie der Kontext, in dem Bedeutungen vergeben werden, unmittelbar mit in den Inhalt der Bedeutungen einfließt. In dem Setting einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt ist von vornherein definiert, wer "verrückt" ist und wer nicht, ebenso wie im Knast klar ist, wer die Schlüssel hat und wer nicht. Der Grund, warum der Patient als "verrückt" gilt, liegt zunächst nur darin, daß er sich in dieser Situation befindet, in die er aufgrund einer entsprechenden Diagnose geraten ist. So kann es passieren, daß wohlmeinende ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen - ich will ihnen keinesfalls bösen Willen unterstellen, weil sie selber innerhalb dieses Systems stecken -, in Gefahr sind, die Dinge nur noch durch die vom Kontext bestimmte Brille zu sehen.
Wenn ich dieses Beispiel aus dem psychiatrischen Bereich erwähne, dann weil sich dort die diskutierten Phänomene sehr deutlich und plastisch zeigen und weil sie dort auch schon gründlicher untersucht worden sind. Ich will damit auf keinen Fall suggerieren, daß solche Vorgänge nicht auch bei uns, in unseren psychotherapeutischen Praxen und anderen Einrichtungen, geschehen würden, im Gegenteil. (Die oben geschilderte Begebenheit am Rande unseres Supervisions-Seminars macht das klar.) Wir müssen vielmehr von diesen Beispielen auch auf uns selbst zurückschließen und uns bewußt sein, daß wir, sobald wir mit unseren KlientInnen in unseren Therapiezimmern sitzen, sobald also definiert ist, wer TherapeutIn ist und wer KlientIn ist und daß dies eine Therapiesituation ist, - daß wir allein aufgrund dieser Tatsachen einem Verhalten möglicherweise eine Bedeutung geben, die wir ihm unter anderen Umständen nicht zuordnen würden. Nur weil ich als "Therapeut" in der "Therapiesituation" die "KlientInnen" betrachte, kann mir manches Verhalten an ihnen als auffällig oder gar abnorm erscheinen. Würde ich dasselbe Verhalten im Alltag, z.B. in einem Café, beobachten, schiene es mir vielleicht nebensächlich oder ich würde es als Schrulle abtun und es gar nicht weiter beachten.
Diese Gegebenheit kann bis zu einem geradezu absurden Extrem führen. TherapeutInnen, die die Deutungsmacht 100%ig für sich in Anspruch nehmen, können in die Gefahr geraten, ihre Interpretation einer Situation entgegen vieler ihr widersprechender Informationen unbeirrbar und unerschütterlich aufrecht zu erhalten; weil sie die "TherapeutInnen" sind, halten sie ihre Sicherheit für den Ausdruck ihrer Kompetenz. Die KlientInnen, die ihnen gegenüber sitzen und ihre Interpretation der Situation ebenfalls entgegen vieler ihr widersprechender Informationen unbeirrbar und unterschütterlich aufrechterhalten, geraten dagegen, nur weil sie die "KlientInnen" sind, in den Verdacht, unter Wahnvorstellungen zu leiden. Beide halten an ihrem Glaubenssystem fest, obwohl es Informationen gibt, die ihnen widersprechen, weil beide ihre Deutungen nicht durch die Einbeziehung des jeweils anderen und des Kontextes überprüfen; sie tun damit prinzipiell dasselbe. Nur, die einen sind die "TherapeutInnen" (also die "Gesunden") und die anderen sind die "KlientInnen" (also die "Kranken"). Die Anwendung eines Wahnsystems definiert in diesem Extremfall, was als Wahnsystem gilt.
Einseitige Deutungsmacht und
notwendige Unsicherheit
Ich ziehe aus all diesen Überlegungen die folgende Lehre: Wenn ich als Therapeut, ohne die Deutungsmacht mit meinen KlientInnen zu teilen, einseitig für mich in Anspruch nehme, die Bedeutung, die ein bestimmtes Verhalten meiner KlientInnen hat, festlegen und benennen zu können, kann ich eigentlich nur unsicher sein - oder aber scheinsicher. Sollte ich mich unter diesen Voraussetzungen sicher fühlen, habe ich ausgeblendet, was ich weiß, nämlich welche Irrtümer aufgrund einer einseitigen Ausübung von Deutungsmacht entstehen können, und ich deshalb in Wahrheit nur scheinsicher bin. Oder ich nehme mein Wissen ernst; dann weiß ich, daß ich unter diesen Bedingungen keine andere Wahl habe und unsicher sein muß. Diese Unsicherheit ist der gegebenen zwischenmenschlichen Realität angemessen und darum zu begrüßen!
Nun komme ich aber mit meinem wichtigen Bedürfnis nach Sicherheit, von dem oben die Rede war, ins Gehege. Wie soll ich meine Unsicherheit begrüßen können, wenn ich zugleich den legitimen und therapeutisch sinnvollen Wunsch nach Sicherheit habe?
Kultivierte Unsicherheit
Meine Idee davon, wie dieses Dilemma zu überwinden sein kann, geht dahin, die Unsicherheit nicht in dem naiven und unproduktiven Zustand zu belassen, der einen orientierungslos und handlungsunfähig macht und einem jede Überzeugungskraft gegenüber den KlientInnen nimmt, sondern die Unsicherheit stattdessen zu kultivieren. Was ich nicht abschaffen kann und in diesem Fall auch nicht abschaffen will, muß ich kultivieren.
Die Kultivierung der Unsicherheit bedeutet für mich zweierlei: Erstens muß ich mir bewußt bleiben, daß immer, wenn ich mir im Zusammenhang mit meiner Zuordnung von Bedeutungen unsicher bin, ich es mit einem erwünschten, positiven, erfreulichen Gefühlin mir zu tun habe, das mich darauf hinweist, daß ich die zwischenmenschliche Realität noch einigermaßen im Blick habe. Meine Unsicherheit ist dann nichts Negatives, das ich zu bekämpfen oder zu überwinden hätte, sondern etwas Positives, das mir auf einer anderen Ebene insofern eine gewisse Sicherheit geben kann, als es mich in der Realitätsbezogenheit meines Erlebens bestätigt.Meine Unsicherheit unterstützt mich, daran zu denken, daß ich gerade eine einseitige Vergabe von Bedeutung vornehme, und regt mich dadurch an, mein Gegenüber in diesen Prozeß miteinzubeziehen.
Die Unsicherheit zu kultivieren bedeutet zweitens, die Unsicherheit therapeutisch nutzen zu können, d.h. Einstellungen und Vorgehensweisen zu kennen und zur Verfügung zu haben, die es möglich machen, sowohl für mich eine Orientierung zu gewinnen als auch für die KlientInnen eine Unterstützung in ihrem Veränderungsprozeß zu geben. Dann kann ich unsicher bleiben, ohne handlungsunfähig zu werden. Ich kann unsicher bleiben, ohne die Orientierung zu verlieren. Und ich kann mit Überzeugung und der entsprechenden Überzeugungskraft gegenüber den KlientInnen hinter meiner Unsicherheit stehen, so daß sie auch auf dieser Ebene produktiv wird.
Aus meiner Sicht gibt es im Repertoire der Gestalttherapie eine lange Reihe von Einstellungen und Vorgehensweisen, die die Unsicherheit von TherapeutInnen unterstützen und zu ihrer Kultivierung beitragen können. Auf einige von ihnen möchte ich nun im einzelnen eingehen. Ich erhebe dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verstehe die folgenden Punkte als Anregungen. Mir kommt es darauf an, die Vielseitigkeit unseres theoretischen und methodischen Hintergrunds in der Gestalttherapie deutlich zu machen, der uns helfen kann, auf die Scheinsicherheit konventioneller Diagnostik und anderer Formen des Schubladen-Denkens zu verzichten und stattdessen unsere Unsicherheit therapeutisch zu nutzen. Kultivierte Unsicherheit ist für mich, so betrachtet, eine gestalttherapeutische Haltung (vgl. auch Miller, 1990).
Ich-Du-Beziehung
Martin Buber (1984) hebt in seiner philosophischen Anthropologie hervor, daß alle Menschen in einem wichtigen Punkt gleich sind: Sie sind einzigartig. Er meint damit keine Besonderheit, die jemandem einen größeren oder geringeren Wert zuschreiben würde,sondern die in jedem Menschen anzutreffende Einmaligkeit seines persönlichen Wesens. Kein Mensch ist wie der andere, jeder ist anders. Wenn man das ernst nimmt, muß man gegenüber jeder Person damit rechnen, in ihr etwas Neuartiges kennenlernen zu können, etwas, das sie von jedem anderen Menschen unterscheidet.Jeder Klient und jede Klientin, der/die zu mir kommt, ist anders als alle anderen, mit denen ich früher schon zu tun hatte. Es wäre von daher merkwürdig, wenn ich schon nach kurzer Zeit sicher zu wissen meinen würde, mit wem ich es zu tun habe. Die unumgängliche Unsicherheit, die ich in der Begegnung empfinde, kann, wenn ich sie kultiviere, zur Neugierde werden, mit der ich jedem Menschen gegenübertrete, um herauszufinden, inwiefern er einmalig und anders als alle anderen ist.
Das geht natürlich nur, wenn ich von vornherein bereit bin, in dieser Person ihre Einzigartigkeit zu suchen und nicht die tausendste Verkörperung einer bestimmten diagnostischen Kategorie. Die Zurückweisung vorgeformter Kategorien ist eine notwendige Voraussetzung dafür, einen Menschen in seiner Einmaligkeit zu erfassen. Die Unsicherheit, die es in mir hervorrufen mag, mich immer wieder auf etwas Neues einzulassen, kann aber in ihrer kultivierten Form als vorbeugendes Hilfsmittel gegen professionelle Langeweile und Routine wirken und mich darin unterstützen, in meiner Arbeit lebendig zu bleiben.
Wenn ich mich auf neue Begegnungen einlasse, verzichte ich auf die Haltung eines quasi-objektiven Beobachters, der aus der Zurückgezogenheit eines von konventionellen diagnostischen Begriffen geprägten Blickwinkels sein Gegenüber einschätzt und einordnet. Ich begebe mich auf die Ebene des unmittelbaren, persönlichen Kontakts, in dem die Subjektivität sowohl der KlientInnen als auch meine eigene zur entscheidenden Dimension werden. Ich gebe dabei die Sicherheit auf, die mir ein Subjekt-Objekt-Verhältnis gegenüber meinen KlientInnen geben kann. Jeder Versuch, meine Subjektivität auszuschalten, würde aber bedeuten, mein eigenes, immer subjektives Menschsein auszuschalten und meinen KlientInnen damit jenes menschliche Gegenüber vorzuenthalten, an dem sie wachsen können. Die mit meiner Subjektivität verbundene Unsicherheit kann, so betrachtet, zu einem Gewinn an Menschlichkeit werden (vgl. Staemmler, 1993).
Phänomenologie
Eine der für mich in der therapeutischen Arbeit wichtigsten Methoden der Phänomenologie ist die des "Einklammerns" (vgl. Husserl, 1980, S. 53ff.). Damit ist das Bemühen von ForscherInnen - oder auch PsychotherapeutInnen - gemeint, ihre Vorannahmen, Vorurteile und ihr Vorwissen über den Gegenstand ihrer Betrachtungen zeitweilig außer Kraft zu setzen, eben "einzuklammern". Man versucht, sich auf diese Weise so weit wie irgend möglich davon frei zu machen, was man bereits zu wissen glaubt, und stattdessen einmal mit neuem, frischen Blick hinzuschauen. So kann sich der Blickwinkel erweitern, die Perspektive verändern. Das gelingt natürlich immer nur in einem gewissen Rahmen und zu einem gewissen Ausmaß; dennoch ist es nützlich. Dazu ein Beispiel:
Ernesto Spinelli (1989, S. 56), dessen Buch ich jedem, der Englisch lesen kann, wärmstens empfehle, berichtet von einer in diesem Zusammenhang interessanten Untersuchung. Zwei Gruppen von Versuchspersonen wurde dieselbe Reihe von Gegenständen gezeigt. Es handelte sich dabei teilweise um bekannte, teilweise um unbekannte Stücke. Die erste Gruppe wurde gebeten, für jeden Gegenstand den Satz zu vervollständigen "Dies ist ...", die zweite erhielt den Satzanfang "Dies könnte sein ...". Es zeigte sich, daß in der zweiten Gruppe eine wesentlich größere Anzahl von möglichen Funktionen und Verwendungszwecken (auch für die bekannten Gegenstände) genannt wurden. Offenbar hatte allein die Einklammerung der Annahme, jeder Gegenstand habe eine festgelegte Bedeutung, eine große Wirkung auf die Variabilität der Beschreibungen. - Man könnte daraus die Vermutung ableiten, Unsicherheit in ihrer kultivierten Form führt zu Kreativität.
Eine zweite Vorgehensweise der Phänomenologie ergibt sich beinahe von selbst aus der Methode des Einklammerns. Wenn man sich möglichst unvoreingenommen mit einem Gegenstand oder einem anderen Menschen beschäftigen will, ohne bereits theoretische Vorannahmen oder irgendwelche Interpretationen ins Spiel zubringen, muß man sich zunächst einmal auf das beziehen, was man wahrnehmen und beschreiben kann. Es ist dabei klar, daß unsere Wahrnehmung, genau betrachtet, bereits eine Fülle von Interpretationen enthält und selbst immer subjektiv ist, da sie sowohl von Sozialisationsbedingungen beeinflußt als auch von den biochemischen, physiologischen sowie von manchen angeborenen psychologischen Faktoren unseres Organismus determiniert ist. (Wie anders die Welt aussehen kann, wenn sich nur die biochemischen Voraussetzungen der Wahrnehmung, z.B. durch die Einnahme bestimmter Drogen, ein bißchen verändern, ist ja allgemein bekannt.)
Dennoch können wir versuchen, möglichst viele von diesen Faktoren "einzuklammern" und uns so weit wie möglich auf Beschreibungen von Sinnesdaten zu konzentrieren. So können wir für den visuellen Kanal Farben und Formen benennen oder für den akustischen Kanal Rhythmen und Modulationen usw. Gerade in der Therapie ist es oft sehr fruchtbar, sich untereinander zunächst übersolche Wahrnehmungen und deren Beschreibungen zu verständigen, ohne ihnen gleich irgendwelche Bedeutungen zuzuordnen. Manchmal ist das Einverständnis über das Wahrnehmbare sogar die einzige gemeinsame Grundlage, wenn KlientIn und TherapeutIn in ihren Beurteilungen des Wahrgenommenen sehr stark voneinander abweichen.
Ein weiteres Hilfsmittel für ein phänomenologisches Vorgehen ist die Bereitschaft, alle Informationen, die man als TherapeutIn bekommt, zunächst einmal als gleich wichtig zu behandeln und nicht sofort zu gewichten. Die Neigung, neue Informationen schnell entweder in die Schublade "nebensächlich" oder in die Schublade "wichtig" zu stecken, ist in den meisten Menschen sehr stark und verstellt leicht den Blick auf Konstellationen, die man bislang noch nicht kennengelernt hat. Unter diesem Aspekt ist kultivierte Unsicherheit die Voraussetzung für neuen Entdeckungen.
Konstruktivismus
Unter diesem Stichwort möchte ich einige Punkte nennen, die historisch und inhaltlich eng mit der Phänomenologie verwandt sind. Die konstruktivistische Grundposition ist die Behauptung, die Wirklichkeit werde von Menschen geschaffen; sie sei nicht schon vorhanden und müsse nur noch erkannt werden. Das gilt auch und besonders für die sozialen, psychologischen Wirklichkeiten, mit denen wir es im therapeutischen Bereich zu tun haben. Ich sehe meine KlientInnen also nicht, wie sie "an sich" sind, sondern ich konstruiere sie für mich, und meine jeweilige Konstruktion beeinflußt oft auch die Art und Weise, wie sie selbst ihre Wirklichkeit konstruieren. (Ich erinnere hier noch einmal an die Zitate aus der Ausstellung über die kanadischen Indianer, die ich meinem Textvorangestellt habe.)
Meine Konstruktionen sind natürlich immer subjektiv und relativ.Sie können mir nie die Sicherheit einer Weltsicht vermitteln, die davon ausgeht, man könne die Wirklichkeit erkennen. Die Unsicherheit, die sich daraus für mich als Therapeuten ergeben mag, wird in ihrer kultivierten Form zu einer Bescheidenheit, die mich darin unterstützt, mich nicht über andere Menschen zu erheben und meiner Sicht der Dinge mehr Gültigkeit zuzuschreiben als der Sicht der anderen.
Wenn ich für meine Konstruktionen Verantwortung übernehme, läßt sich die mit ihnen verbundene Unsicherheit überdies zu einem Bewußtsein von Freiheit kultivieren. Denn je bewußter mir ist, daß ich meine Wirklichkeit selbst konstruiere, desto bewußter ist mir,daß ich sie immer auch anders konstruieren kann. Das gibt nicht nur mir als Therapeut eine größere Flexibilität, sondern schafft in der Rückwirkung auf meine KlientInnen oft auch für sie "die Möglichkeit des Andersseins" (Watzlawick).
Die konstruktivistische Grundannahme gilt in besonderem Maße für die Sinngebungen und "Kausal"verknüpfungen, die Menschen im Zusammenhang mit ihren Erfahrungen bilden. Wie oft verhalten wir uns auf eine bestimmte Weise, "weil" wir die Erfahrung gemacht haben, daß sie eine bestimmte Konsequenz hatte. Wir konstruieren solche Zusammenhänge, weil wir dazu tendieren, aus einzelnen Erlebnissen Generalisierungen abzuleiten, die gewährleisten sollen, daß Erfolgserlebnisse sich wiederholen und Frustrationen vermieden werden. Auch weniger weit entwickelte Organismen tun das; ich erinnere an Skinners "abergläubische" Tauben, die in diesem Punkt viel Ähnlichkeit mit uns Menschen haben:
"Skinner setzte je eine Taube in eine, nun nach ihm benannte, ,Skinner-box'. Das ist eine Schachtel, in die man hineinsehen kann, die dem eingesperrten Tier aber nur jene Nachrichten von außen zukommen läßt, die der Experimentator absichtlich in sie hineinschickt. Er steckte eine Reihe Tauben in eine Reihe solcher Schachteln, und die Anordnung war so getroffen, daß ein Uhrwerk in gleichen Abständen in jede Schachtel ein Futterkorn warf. Nun sind auch Tauben keine Reaktionsautomaten, denn auch sie haben Appetenzen und Programme und wollen und tun fortgesetzt irgendetwas: schreiten, gucken herum, putzen sich usf. Folglich mußte das Hereinfallen des Kornes stets mit irgendeiner Bewegung koinzidieren. Und nun ist es nurmehr eine Frage der Zeit, bis das Futterkorn mehrfach mit ein und derselben Bewegung zusammenfällt. Von diesem Augenblick an beginnt ein merkwürdiger Lernprozeß. Die jeweilige Bewegung wird mit der Futtergabe assoziiert, die Bewegung - sagen wir, ein Schritt nach links - wird nun öfter gemacht. Die Koinzidenz wird folglich häufiger. Die Taube wird in der ,Erwartung' des Zusammenhangs zwischen Futter und dieser Bewegung zunehmend bestärkt, und gewinnt zuletzt eine sozusagen lückenlose Bestätigung dafür, daß jene spezielle, nun fortgesetzt gemachte Bewegung Futter zur Folge hat, da, wenn sie sich immer nur nach links wendet, jedes Futterkorn eine Belohnung und Bestätigung bringen muß. Das Ergebnis sind lauter verrückte Tauben; eine dreht sich nur links herum im Kreise, eine andere spreizt fortgesetzt den rechten Flügel, eine schwenkt pausenlos den Kopf"(Riedl, in: Watzlawick, 1985, S. 76f.).
Es kränkt vielleicht unseren menschlichen Stolz, aber die Vermutung scheint mir dennoch berechtigt, daß viele der Sinnzusammenhänge, die wir im Laufe unseres Lebens konstruieren, kaum rationaler als die der Tauben, sondern auch mehr oder weniger abergläubisch sind. Für mich ist diese Vermutung nicht nur eine Ermutigung, die Zusammenhänge, die meine KlientInnen für sich konstruieren ("Ich bin so bzw. verhalte mich so, weil ...") zu hinterfragen. Ich sehe sie zudem als Unterstützung für mich, auch meine Konstruktionen von meinen KlientInnen ("Die oder der ist bzw.verhält sich so, weil ...") immer wieder zu überprüfen. Das verunsichert mich zwar immer wieder, läßt mein Vorgehen jedoch, wie ich hoffe, etwas kultivierter werden als das von Tauben - was meinen Stolz dann wieder etwas besänftigt.
Feldtheorie
Die psychologische Feldtheorie von Kurt Lewin (1963), die einen wichtigen historischen Hintergrund der Gestalttherapie darstellt, sehe ich als eine weitere wichtige Quelle für die Kultivierung der therapeutischen Unsicherheit. Lewin hat nachdrücklich gezeigt,wie abhängig das jeweilige Verhalten eines Menschen vom gesamten Feld, also der Summe aller gegebenen Einflüsse, ist. Zu einem solchen Feld gehört immer auch derjenige, der es beobachtet (vgl. auch Portele, 1990, oder Parlett, 1991). Man muß nur einmal an den Gesichtsausdruck denken, den viele Menschen auf Fotos zeigen; er ist oft Ausdruck für die verkniffene Reaktion auf das Fotografiert werden selbst und nicht unbedingt Ausdruck genereller Verkniffenheit der fotografierten Person.
Das heißt für das Feld von KlientInnen in Therapien, daß ihr jeweiliges Verhalten nur zu verstehen ist, wenn man auch den Einfluß bzw. die Wirkung der TherapeutInnen berücksichtigt. Unsere KlientInnen verhalten sich uns gegenüber und in unserer Anwesenheit und in der Therapiesituation anders als unter anderen Umständen. Jede "Diagnose", die ich mache, ist darum nur vollständig,wenn sie die Einflüsse einbezieht, unter denen sie zustandekommt, z.B. die Tatsachen, daß jemand anwesend ist, der diagnostiziert,wie der Diagnostizierende sich gegenüber dem zu Diagnostizierenden verhält, wie der eine den anderen sieht usw. Daraus folgt aber auch die Einsicht: Die Generalisierbarkeit der Diagnose hat Grenzen. Sie läßt sich nicht ohne Weiteres auf andere Situationen übertragen, in denen die/der Betreffende sich in einem anderen Feld befindet. Für jedes Feld gilt seine "Singularität" und die jeweils gegenwärtige "Zeitperspektive", um zwei weitere Begriffe von Lewin zu erwähnen, die hier wichtig sind.
Jeden Eindruck, den ich von meinen KlientInnen gewinne, gewinne ich zu einem einmaligen Zeitpunkt, in einer nicht zu wiederholenden Situation und unter meinem speziellen Einfluß. Die hier maßgeblichen Faktoren sind so vielfältig, daß jede Unsicherheit, die in mir hinsichtlich der Allgemeingültigkeit meines Eindrucks aufkommt, nur als angemessener Reflex auf die Vielseitigkeit, Komplexität und, vor allem, auch die Veränderlichkeit des Feldes verstanden werden kann.
Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt:
Prozeß-Orientierung
Die Gestalttherapie hat immer besonderen Wert auf die Tatsache gelegt, daß Menschen, ja sogar Dinge, nichts Festes, Unbewegliches und Unveränderliches sind, sondern sich ständig in Veränderung befinden. Darum ist auch das Wort "Prozeß" einer der zentralen Begriffe in der Gestalttherapie (vgl. Staemmler u. Bock, 1991).Häufig hat man sich in diesem Zusammenhang auf eines der wenigen überlieferten Fragmente der Lehren des alten Griechen Heraklit berufen und ihn mit dem Satz zitiert: "Alles fließt." Es gibt aber noch ein weiteres Fragment, in dem Heraklit das Bild von dem Fluß benutzt. Es lautet:
"Bei einem Fluß ist es nicht möglich,zweimal hineinzusteigen in denselben, auch nicht ein sterbliches Wesen zweimal zu berühren und zu fassen im gleichen Zustand..."(1952, S. 27).
Damit ist gesagt, daß Menschen sich in ständiger Veränderung befinden. Wer heute so und so ist, kann schon morgen oder übermorgen anders sein. Diese Veränderung mag mehr oder weniger schnell, manchmal sogar sehr langsam vor sich gehen und daher nicht leicht wahrzunehmen sein. Es ist darum manchmal nötig,einen längeren Zeitraum in die Betrachtung einzubeziehen, wenn man Veränderung als solche erkennen will (vgl. Yontef, 1988). Es ist wie bei einem Film: Wenn man nur einen kurzen Ausschnitt anschaut, sieht man ein feststehendes Bild, erst mit der Zeit wird Bewegung sichtbar. Unveränderlichkeit ist daher eher das Resultat einer verkürzten Sichtweise, nicht so sehr die Eigenschaft dessen, den man betrachtet; auch eine statische Diagnose sagt darum mehr über den, der sie trifft, als über den, den sie betrifft.
Das Fazit aus dieser Tatsache ist zugleich das Fazit meines gesamten Textes: Veränderlichkeit bringt die Unsicherheit mit sich, nicht zu wissen, was im nächsten Moment, am nächsten Tag oder im nächsten Jahr sein wird. Diese Unsicherheit zu kultivieren, heißt optimistisch zu werden und Veränderung selbst dann für möglich zu halten, wenn man sie (noch) nicht erkennen kann. Das bedeutet auch die Bereitschaft, jeden einmal gewonnenen Eindruck von unseren KlientInnen, wenn nötig, schon in nächsten Augenblick wieder über Bord zu werfen und sich immer wieder ein neues Bild zu machen.
Bertolt Brecht (1967, S. 749) hat es unter der Überschrift "Die Folgen der Sicherheit" bildhaft so gesagt:
Ich höre, du willst / Deinen Wagen noch einmal wenden an der Stelle / Wo du ihn schon einmal gewendet hast. Dort / War der Boden hart. / Tue es nicht! Bedenke / Indem du deinen Wagen gewendet hast / Sind Furchen in den Boden gekommen. Jetzt / Wird dein Wagen dort steckenbleiben.
Literatur
Brecht, B.: Gesammelte Werke in 20 Bänden, Bd. 9, Frankfurt/M., 1967
Buber, M.: Das dialogische Prinzip, Heidelberg, 1984
Davison, G. C.; Neale, J. M.: Klinische Psychologie - Ein Lehrbuch, München/Wien/Baltimore, 1979
Heraklit: Urworte der Philosophie, Wiesbaden, 1952
Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Psychologie, Tübingen, 1980
Lewin, K.: Feldtheorie in den Sozialwissenschaften, Bern, 1963
Marquez, G. G.: Zwölf Geschichten aus der Fremde, Köln, 1993
Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit, Reinbek, 1981
Miller, M. V.: Toward a Psychology of the Unknown, in: The Gestalt Journal,1990, 13/2, 23-41
Parlett, M.: Reflections on Field Theory, in: The British Gestalt Journal,1991, 1/2, 69-81
Portele, H.: Feld und Interdependenz - Zu den Grundlagen der Gestalttherapietheorie bei Lewin und Bourdieu, in: Gestalttherapie, 1990, 4/2, 17-27
Riedl, R.: Die Folgen des Ursachendenkens, in: Watzlawick, 1985, S. 67-90
Rosenhan, D. L.: Gesund in kranker Umgebung, in: Watzlawick,1985, S. 111-137
Spinelli, E.: The Interpreted World - An Introduction to Phenomenological Psychology, London / Newbury Park /New Delhi, 1989
Staemmler, F.-M.: "Etiketten sind für Flaschen, nicht für Menschen" - Anmerkungen zur Diagnostik-Diskussion, in: Gestalttherapie, 1989, 3/1, 71-77
Staemmler, F.-M.: Therapeutische Beziehung und Diagnose - Gestalttherapeutische Antworten, München, 1993
Staemmler, F.-M.; Bock, W.: Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie, München, 1991
Watzlawick, P. (Hrsg.): Die Erfundene Wirklichkeit - Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? - Beiträge zum Konstruktivismus, München, 1985
Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft - Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen, 1985, Bd. 2
Yontef, G.: Comments on 'Boundary Processes and Boundary States', in: The Gestalt Journal, 1988, 11/2, 25-35

FRANK-M. STAEMMLER, Dipl.-Psych., geb. 1951, Mitbegründer des ãZentrums für
Gestalttherapie" in Würzburg, ist dort seit 1976 als Gestalttherapeut, Ausbilder und Supervisor tätig. Er ist Autor zahlreicher Artikel und mehrerer Bücher zu gestalttherapeutischen Themen. Zuletzt erschienen "Therapeutische Beziehung und Diagnose - Gestalttherapeutische Antworten" und "Der 'leere Stuhl' - Ein Beitrag zur Technik der Gestalttherapie". Gemeinsam mit Werner Bock verfaßte er ein Buch über die Theorie des Veränderungsprozesses in der Gestalttherapie ("Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie"), das als Neuauflage in der Edition der Gestalt-Instituts Köln im Peter Hammer Verlag erschienen ist.
Gerne senden wir Ihnen weitere Infos zu diesem Buch. Hier unsere eMail-Anschrift: