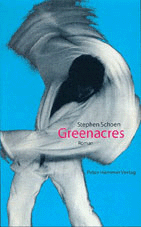
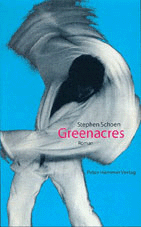


Und schließlich die
Leseproben:
Leseprobe 1: Anke und Erhard Doubrawa, Zum Geleit
"Was mir sehr deutlich wird, ist, dass unsere Arbeit in der Therapie auch etwas wachruft, es ist ein Ruf an die Seele, und für die Patienten ist es oft das erste Mal, dass sie diesen Ruf vernehmen." Robin DeWitt (in diesem Roman)
Liebe Leserin, lieber Leser,
im Kapitel 10 dieses Romans das Gespräch des alten und weisen Psychiaters Lawrence mit dem Protagonisten zu lesen, ist für uns wie eine leibhaftige Begegnung mit dem Autor selbst, unserem Kollegen und Freund Stephen Schoen.
Es zeigt in ermutigender Weise, welche Veränderungen angesichts einer therapeutischen Begegnung möglich sind, die erfüllt ist vom Licht des Buberschen Ich-Du und in der der Klient sich in seinem Wesen angesprochen und gemeint weiß.
In Therapiegruppen sitzt Stephen häufig neben seinem Klienten, ihm ganz zugewandt, interessiert. Er weiß, was er tut. Er bietet dem Klienten den Nektar, den er selbst in seiner Kindheit, seiner Jugend und als junger Mann so entbehrte und der ihm dann als Klient in der Therapie, in seiner Begegnung mit Jiddu Krishnamurti und schließlich in Lektüre von Bubers Dialogischer Philosophie zur Heilung gereicht wurde.
Oft berührt er dabei sein Gegenüber auch physisch, nie aber ist er aufdringlich. Durch seinen Respekt vor den eigenen Grenzen und denen der anderen haben diese Berührungen eine fast sakramentale Qualität, wenn man darunter die äußere, sichtbare Manifestation des inneren, unsichtbaren Heilungsprozesses versteht.
Wir freuen uns, Ihnen, im Rahmen unserer "Edition des Gestalt-Instituts Köln/GIK Bildungswerkstatt" im Peter Hammer Verlag, als 20stes Buch zum ersten Mal einen Roman präsentieren zu können, diesen besonderen Roman: Einen einfühlsamen und gleichwohl erschütternden Therapieroman des amerikanischen Gestalttherapeuten Stephen Schoen.
Stephen Schoen hat sich von Jugend an intensiv mit Literatur - und übrigens auch mit Musik - beschäftigt. Nach seinem Studium in Harvard lehrte er Englische Literatur an einer Universität in Washington, D.C., lange bevor er später Medizin studierte und Psychiater wurde.
Seine Liebe zur Literatur hat ihn dabei nie verlassen. Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, möchten wir deshalb sein erstes Buch ganz besonders ans Herz legen: "Geistes Gegenwart. Philosophische und literarische Wurzeln einer weisen Psychotherapie" (Edition Humanistische Psychologie), in dem er sich u.a. mit Bubers, Rilkes und Kafkas Bedeutung für die Psychotherapie beschäftigt.
Stephen Schoen war bis dahin ein stiller, schüchterner und zurückgezogener junger Mann gewesen. Während seines Studiums in Harvard kam er in Berührung mit dem Werk des englischen Mystikers William Blake ("Energie ist ewige Freude"). Die Lektüre von William Blakes Schriften - und die persönliche Begegnung mit Jiddu Krishnamurti ("Sein bedeutet: In-Beziehung-Sein") - erlebte er wie ein "Erwachen".
Er nahm diese Erfahrung zum Anlass, psychotherapeutische Hilfe für sich zu suchen. Mit Erfolg. Die eigene Psychotherapie eröffnete ihm nicht nur "die Freiheit befriedigender Beziehungen", sondern begeisterte ihn so sehr, dass er sich für diesen Beruf zu interessieren begann und ihn schließlich auch ergriff.
Beim Lesen dieser Zeilen werden Sie sicher die Nähe der eigenen Biographie des Autors zum unsicheren, jedoch empfindsamen Protagonisten dieses Romans, Richard Adler, gespürt haben. Ja, die Parallelität geht sogar noch einen Schritt weiter: Stephen Schoen selbst war während des Zweiten Weltkrieges mit 18 Jahren wegen seines Pazifismus' unter einem Vorwand in eine solche Klinik eingewiesen worden.
Stephen zu kennen, verdanken wir unserem Lehrer Milan Sreckovic. Milan hat - auf die Initiative von Lore Perls hin, der Mitbegründerin der Gestalttherapie - Stephens erstes, bereits erwähntes Buch in deutscher Sprache veröffentlicht. Milan war es auch, der uns empfohlen hat, Stephen in unser Institut einzuladen.
Aus unserer Zusammenarbeit mit Stephen Schoen ist noch ein weiteres Buch hervorgegangen: "Wenn Sonne und Mond Zweifel hätten. Gestalttherapie als spirituelle Suche" (Edition GIK im Peter Hammer Verlag).
Inzwischen ist Stephen ein gern gesehener Gast, ein geschätzter Lehrtrainer in unseren Gestalttherapie-Ausbildungen und mehr noch: ein vertrauter, wertvoller, herzlicher Freund.
An dieser Stelle möchten wir Magdalene Krumbeck vom Peter Hammer Verlag ausdrücklich für ihre einfühlsame und ausdrucksstarke Umschlaggestaltung herzlich danken - sowohl für dieses Buch, als auch für die 19 vorhergehenden in dieser Reihe.
Wir wünschen Stephens Roman, dass er auch Ihr Herz erreicht.
Und wir wünschen unserem Freund alles Liebe und Gute.
Anke und Erhard Doubrawa, Herausgeber
Gestalt-Institut Köln/GIK Bildungswerkstatt
www.gestalt.de · gik@gestalt.de
Leseprobe 2: Kapitel 1: Im Wartezimmer
Es wird nicht so laufen, wie sie es sich vorgestellt hat! Arme Mutter. Wie sie da sitzt auf der schmalen Couch. Unruhig wippt sie mit dem Bein und zerreißt dabei ein Bonbonpapier. Sie wird Zeit brauchen, um sich wieder zu beruhigen, aber deshalb sind wir ja hier. Eichenvertäfelte Wände, ein Kashan-Teppich mit Rotwild- und Vogelornamenten, rosa und goldfarbene Lampenschirme, Duncan-Phyfe Stühle mit gekreuzten Beinen und den typischen zierlichen, halbkreisförmigen Rückenlehnen - ein richtiges Wartezimmer, eine Welt voller Annehmlichkeiten. Und ich, ich sitze auf einem harten Mahagonistuhl - ihr gegenüber.
Der Abschied war unvermeidbar, und während ich sie anschaue, so traurig und allein wie sie ist, werde ich selber traurig. Aber ich brauche diesen Abstand; allein schon diese drei Meter zwischen uns tun mir irgendwie gut. Ich komme mir vor wie ein Regisseur, der vom Zuschauerraum aus die Bühne betrachtet und sich vergewissert, dass die Protagonistin auch wirklich im Mittelpunkt steht.
Eine Sekunde lang sieht sie mich an, wendet dann aber ihren Blick schnell wieder ab und betrachtet die Papierfetzen auf ihrem Schoß. Dieses Theater hat etwas Würdeloses, und ich habe keine Ahnung, was ich tun könnte, um unsere Situation zu entkrampfen.
Die letzten Monate erscheinen mir wie ein großer Kreis: zuerst die Auflösung des Zentrums für Frieden und Gerechtigkeit in Berkeley, dann Kims Abreise und heute das hier. Viel war eigentlich nicht zwischen uns, aber wir wollten uns trotzdem nicht aus den Augen verlieren - die Erinnerungen sind ein bisschen durcheinander geraten. Angefangen hatte es bei den Aufführungen des Streichquartetts in der Universität, wo sie als Platzanweiserin arbeitete. Sie war sehr tüchtig und wirkte doch irgendwie schüchtern. Einmal blieb ich nach dem Konzert noch da, um sie zum Bus zu begleiten. Ab und zu nahm ich sie mit nach San Franzisko zur Philharmonie. Sie war klein und trug kein Make-up, dafür aber diese große Schildpattbrille. Wenn wir zusammen waren, nahm sie die Brille manchmal ab und dann leuchteten ihre Augen. Sie erzählte mir von ihrem Leben in Berkeley, wo sie allein lebte, und von ihrem Soldaten in Texas. Sie wollten heiraten. Ich hörte ihr gerne zu. Manchmal kam ich mir dabei vor wie ein erfahrener Berater, obwohl ich erst neunzehn war und sie schon einundzwanzig.
Ab und zu erzählte ich auch von mir, über das, was ich etwas großspurig meinen "spirituellen Weg" nannte, und dass ich die Literatur eventuell aufgeben und eine Rabbinerschule besuchen würde. Ich hatte vor, ihr das Zentrum zu zeigen, wo ich zweimal im Monat für eine Hand voll Jugendlicher Vorträge zu Themen wie "Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen" oder "Meister Eckharts Begriff der geistigen Armut" hielt. Eigentlich fühlte ich mich vollgestopft mit leerem Wissen - vielleicht nicht wirklich leer, aber irgendwie unbewegt, ich trat auf der Stelle. Und dass sie nicht mitkommen wollte, schien mir ehrlich zu sein, ehrlicher jedenfalls als ich mir selbst vorkam.
"Ich heirate einen Soldaten", sagte sie mit einem breiten Lächeln. "Ich habe keine Gewissensbisse."
Das Zentrum für Frieden und Gerechtigkeit war für mich eine Art "Sesam öffne dich", und ich hatte die Idee, selbst etwas Ähnliches ins Leben zu rufen. Als ich vor drei Wochen wieder hin kam, um einen Vortrag zu halten, war es geschlossen. Sie hatten kein Geld mehr, aber mir hatte keiner etwas gesagt.
Da stand ich nun an diesem warmen Frühlingsabend und dachte: Diese Tür ist nun zu, aber ich werde etwas finden, das sich nicht verschließen wird.
Kim fuhr am nächsten Tag nach Fort Worth. Ihr Freund Dave wollte sie sehen, weil er ein paar Wochen später nach Bosnien musste, und ich brachte sie nach San Franzisko zum Greyhound-Busbahnhof. Sie hatte mir ein Geschenk mitgebracht, das ich erst öffnen durfte, als wir am Busbahnhof angekommen waren. Es war ein langer, tiefblauer Wollschal mit Schlüsselmuster und Zotteln, den sie selbst gehäkelt hatte.
"Kim, das ist das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe."
"Ich möchte, dass du mich nicht vergisst", sagte sie.
"Ich werde dir schreiben. Und bitte, schreib mir auch."
"Ja."
Ich hielt ihre Hand, als hätte sie sich noch nicht endgültig entschieden zu fahren.
"Mach dir um mich keine Sorgen", sagte sie. "Er liebt mich."
Ich dachte: Wir hatten viel zu wenig voneinander. Warum geht sie fort?
Dann umarmte sie mich. "Auf Wiedersehen Rick."
"Ich schreibe dir."
"Ich will doch wissen, was du so machst."
"Ich glaube, das weiß ich selbst noch nicht."
"Okay."
Sie verschwand durch das Tor. Wie im Traum ging ich zurück zum Auto und fuhr ziellos nach Norden, Richtung San Franzisko Bay. Jetzt ist auch das vorbei, dachte ich. Es gab eine Reihe von Abschieden. Aber was genau war eigentlich vorbei? - Ich fühlte mich irgendwie verloren, und doch hatte ich plötzlich ein stilles Glücksgefühl, stärker als ich es je zuvor erlebt hatte. Ohne etwas Konkretes im Sinn zu haben, sagte ich mir: Sie hat begonnen, ihr Leben zu leben. Es wird Zeit, dass ich anfange, meines zu leben.
Eigentlich hatte ich ein Seminar an der Uni, aber das war jetzt unwichtig geworden. Der Wagen rollte, und ich fuhr die Marina entlang und dann weiter über die Golden Gate Bridge. Der Tag gestaltete sich selbst, und das war gut so. Ich empfand Klarheit und Verwirrung - und Vertrauen in eine unbestimmte Zukunft.
Als ich San Rafael hinter mir gelassen hatte und weit genug von der Universität entfernt war, verließ ich die Autobahn, um dem dichten Verkehr zu entgehen und kam zu einem völlig überfüllten Einkaufszentrum. Ich fuhr weiter in eine abgelegene Straße am Fuß eines Hügels, parkte und ging zu Fuß weiter. Ein Stückchen weiter oberhalb wurde die Straße durch einen Graben geteilt, aus dem schwere Eichen ihre Äste dem Pflaster entgegen streckten. Ich berührte die Blätter der Bäume, und sie fühlten sich an wie der Boden des Grabens, aus dem sie herausragten. Die Straße mündete in eine andere, die weiter hinauf führte, an Häusern vorbei, die hinter Bäumen versteckt lagen, und verlor sich dann irgendwo in den Bergen. Am Himmel zeigte sich ein blasser, voller Nachmittagsmond. Ich folgte der Straße, die jetzt von roten und weißen Oleanderbüschen umsäumt war. Neben den Masten der Stromleitungen erhoben sich große Magnolien- und Eukalyptusbäume.
Plötzlich war ich im Himmel. Mir war, als teilten Bäume und Himmel ein Geheimnis mit mir, ein Geheimnis, das weder ihnen noch mir gehörte, sondern das uns geschenkt wurde. All das kam völlig unerwartet. Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen; und wieder spürte ich - deutlicher als ich es jemals für möglich gehalten hätte, dass ich fest auf dem Boden stand.
Vor Freude begann ich zu weinen. Eine Bürde war von mir abgefallen, die Erlösung von einem Übel, das mir nicht bewusst gewesen war. Das erleichterte Seufzen ungezählter reumütiger Sünder lag in der Luft und ging in die friedliche Stille des hellen Tages über.
Wie mechanisch ging ich während der folgenden Tage zur Universität. Die moderne Dichtung, die großen russischen Schriftsteller, die humanistische Psychologie, all das bildete nun den Hintergrund für ein Drama, das im Begriff war, sich zu entfalten. Ich spürte meine Hand- und Fußgelenke wie ein Läufer beim Start des Rennens. Ein paar Tage später verabredete ich mich mit meinem Freund Jess zum Abendessen; ich wollte ihm alles erzählen.
"Ich habe ein klares Gefühl der Würde", sagte ich. "Einfach während ich hier sitze." Jesses Blick öffnete sich. "Es klingt abgedroschen, aber es ist die Würde des Seins."
"Für mich hat es dir nie an Würde gefehlt", sagte Jess.
"Für dich."
"Was ist passiert?"
"Ich kann es dir nicht sagen", antwortete ich, aber gleichzeitig wollte ich doch etwas sagen. "Als ob die Dinge sich von selbst ergeben - wie Puzzlestücke, die ihren Platz von alleine finden." Jess sah mich mit seinem durchdringenden Blick an, den Oberkörper wie immer leicht nach vorn gebeugt.
Er ging erst seit diesem Frühjahr wieder zur Schule, nachdem er zuletzt in einem Sägewerk gearbeitet und eine schmerzliche Beziehung zu einem jungen Mann gehabt hatte, die ich nicht verstand. Aber ich hatte den größten Respekt vor der Intensität seines Fühlens, und mit einem gewissen Stolz sagte ich: "Du hast mal gesagt, dass ich dich an Oblomov erinnere."
"Oh, Rick, das war ein flüchtiger Eindruck. Du wirktest damals lockerer und entspannter als ich es jemals sein könnte." Er lachte. "Du kennst mich doch; ich brauche Aufregung, Spannung, Dynamik - das ist meine Art von Entspannung."
"Aber es hat gereicht, um mir Angst einzujagen. Als ob ich mein Leben damit verbrächte, auf dem Sofa zu liegen, Zeitung zu lesen und Tee zu trinken. Oder meine Überzeugungen zu verbergen und unter meinem Mantel Bücher vor dem Regen zu schützen, obwohl es gar nicht regnet. Das Zentrum für Frieden und Gerechtigkeit hat zugemacht, aber ich komme mir überhaupt nicht ausgeschlossen vor; im Gegenteil: ich fühle mich frei und aufgeschlossen und keineswegs ängstlich."
"Heißt das, du änderst deine Pläne?"
"Ich weiß nicht, was es heißt. Ich wollte es dir nur erzählen."
Jess lächelte wieder. Wir verließen das Restaurant in der Abenddämmerung und überquerten den oberen Campus in Höhe der Gayley Street. Die Verschwiegenheit des Abends trug mich - wie vorher das Gewölbe der Bäume am Hang. Doch plötzlich wurde ich nervös, so als ob ich mich zwar noch auf sicherem Boden, aber doch in der Nähe eines Abhangs befände, auf dessen anderer Seite Jess stand.
Er deutete auf die andere Straßenseite. "Da drüben geht Paul. Wollen wir ihn fragen, ob er Lust hat, mit uns einen Kaffee zu trinken?"
"Gut. - Nein, nicht jetzt. - Ein andermal …", sagte ich.
"Was ist los?"
"Ich melde mich später bei dir." Ich überquerte die Straße und lief davon.
Zuerst wollte ich einfach allein sein, um mich irgendwie selbst zu prüfen. Die Straße war dunkel und menschenleer. Doch dann bog vor mir ein Auto ab. Der Fahrer, der allein im Wagen saß und seinen Hut weit nach hinten geschoben hatte, sah mich einen langen Augenblick an und fuhr dann langsam weiter den Berg hinauf Richtung Virginia Street, wo es noch dunkler wurde. Sein Blick hatte etwas Unheimliches, und ich war mir nicht sicher ob er mir ein Zeichen geben wollte. Der Blick dieses Mannes erinnerte mich an den starren Blick eines Streifenhörnchens, und im Dunkeln wirkte sein Hut tatsächlich pelzig und gestreift. Aber der Kerl interessierte mich nicht wirklich.
Ich dachte: In Berkeley ist diese Art von Anmache ja nicht selten; aber es war auch irgendwie verlockend. Ich drehte mich um und sah dem Wagen nach, der wieder für einen Moment anzuhalten schien, bevor er am Ende der Straße links in einer Einfahrt verschwand. Ich folgte der Straße, und plötzlich überkam mich am ganzen Körper ein heftiges Schütteln: die Zähne, die Schultern, die Beine - alles zitterte. Mir war nicht klar, wo diese Erschütterung herkam und was sie so heftig machte. Ich hatte das Gefühl, im Maul eines Krokodils zu stecken oder direkt am Rand eines Abgrunds zu stehen, ein paar Hundert Meter weit in die Tiefe zu blicken und jeden Moment springen zu müssen. Ein Gefühl von Verwüstung, das unerträglich war, und das ich doch ertragen musste.
Ich zitterte so sehr, dass ich kaum gehen konnte, folgte der Straße bis zum Ende und näherte mich langsam der Einfahrt. Es war eine lange, dunkle Durchfahrt, die nach etwa zehn Metern nach rechts abbog. Als ich zu der Biegung kam, sah ich vier parkende Autos und der Wagen, den ich gesehen hatte, schien der letzte in der Reihe zu sein.
Da die ersten drei Autos mir die Sicht versperrten, konnte ich nicht viel erkennen, aber es hatte den Anschein, als säße der Mann da im Dunkeln. Ich stand ganz still und zitterte. Eine Minute verging. In dem Wagen bewegte sich nichts. Vielleicht war doch niemand drin. Vielleicht war der Mann hinter dem Parkplatz in einem Durchgang zum Haus verschwunden. Ich spürte wie meine Wachsamkeit schwand, und plötzlich hörte das Zittern auf; ich drehte mich um und ging zügig nach Hause.
Ich nahm mir einen kalten Tee und setzte mich auf die Matratze. Die asketische Einrichtung meiner Wohnung kam mir mit einem Mal so gewollt vor. Ich öffnete den Brief vom Gericht, dessen Inhalt ich schon kannte. Ein förmliches Schreiben, in dem die Unrechtmäßigkeit meiner Kriegsdienstverweigerung festgestellt wurde und in dem man mich aufforderte, unverzüglich entsprechende Schritte zu unternehmen, um eine strafrechtliche Verfolgung zu umgehen. Bis dahin war ich mir nicht sicher gewesen, wie ich auf diesen Brief reagieren sollte. Ich wusste nur, dass er irgendwann kommen würde.
"Das Licht auf dem Berg reicht nicht", sagte ich laut. "Es bedarf auch des lauernden Strudels der Dunkelheit. Ohne sie könnte ich die Fülle nicht spüren."
Ich schrieb ein paar Zeilen unter den amtlichen Brief, führte an, dass meine Einwände gegen die Einberufungsmaschinerie Teil meines Protestes gegen den Krieg seien und adressierte den Brief an die Justizbehörde. Dann ging ich zum Briefkasten, warf den Brief ein und ging langsam durch die stillen Straßen zurück. Ich kam an meinem Haus vorbei und ging weiter zur Derby Street, wo Jess wohnte. Das Haus war dunkel. Ich klopfte an sein Fenster. Er machte das Licht an und ließ mich herein. Er sah mich besorgt an.
"Ist alles in Ordnung?", fragte er.
"Ich habe mich fürchterlich erschreckt."
"Rick, was ist los?"
"Ich weiß nicht, was ich sagen soll."
"Du tust doch sonst nicht so geheimnisvoll."
"Kann ich heute Nacht hier bleiben?", fragte ich.
Mit ernstem Blick sah er mich an. "Klar."
Ich legte mich aufs Bett und empfand die Dunkelheit jetzt als Erleichterung. Nach einer Weile wandte ich mich ihm zu. Er hatte die Hände hinter den Kopf gelegt. Ich kam ein bisschen näher und wollte ihn bitten, mich in den Arm zu nehmen. Er drehte sich zu mir um und wiegte mich in seinen Armen. Von uns beiden war immer ich derjenige gewesen, der sehr vorsichtig mit Umarmungen umging, und ich wusste, dass ich ihn provozierte. Tatsächlich vermittelte Jesses Gegenwart mir das Gefühl von Sicherheit gegenüber dem Mann auf dem Hügel, allerdings mit einer seltsamen Mischung aus Herausforderung und schlechtem Gewissen: Mein bester Freund wurde zum Opfer meiner konfusen Bedürfnisse und ich war hilflos. Ein paar Minuten später fragte er mich: "Rick, möchtest du mehr?"
"Lieber nicht." Seine Frage erleichterte mich. Aber die Förmlichkeit meiner Antwort beschämte mich ebenso sehr wie mein Verhalten. Ich setzte mich auf die Bettkante.
"Ich will dich nicht ausnutzen", sagte ich.
"Aber das tust du, wenn du nichts sagst. - Sag mir wenigstens worum es überhaupt geht."
"Jess, bis jetzt bin ich einfach umhergeirrt, habe mich treiben lassen wie ein formloses Etwas. Aber das bin ich nicht. Gerechtigkeit, Liebe und Gewaltlosigkeit sind ethische Maßstäbe, und das wollte ich anderen nahebringen. Bisher waren das vielleicht nur Worte, aber jetzt bin ich plötzlich durchdrungen von diesem Ideal. All meine Vorstellungen und Pläne die Rabbinerschule zu besuchen und die Welt zu verbessern, waren ein ewiges Hin und Her, ein Zögern und Abwarten. Wenn es in mir eine Wahrheit gibt, dann muss sie jetzt sichtbar werden."
Er setzte sich auf und zog die Beine an.
"Du sagst, du hättest Angst bekommen", sagte er.
"Ich weiß nicht, was es ist, … es ist eine Art reißender Strom. Deshalb wollte ich nach dem Abendessen allein sein. Etwas wollte ausgedrückt werden, etwas, das so viel größer ist als ich und das mich manchmal überwältigt. Aber jetzt, wo die Angst vorbei ist, fühle ich mich sicherer."
Ich stand auf und setzte mich in den Sessel am Fenster. "Ich spüre, dass ich ein besonderes Wissen in mir trage, ein Wissen, das einem Auftrag dient, einem Zweck. Etwas, das jetzt geschehen muss, etwas, das die Welt jetzt braucht. Wie verändert man die Welt? Man kann sie nicht einfach verändern. Aber du kannst dich selbst ändern, kannst dich selbst erschaffen. Klingt das zu grandios?"
Jess lächelte. "Es klingt unangemessen."
"Gut, das soll es auch. Das bestärkt mich sogar noch. Es geht um die Ausweitung dessen, was wir erdulden können. Ich fühle mich stärker, auch dir gegenüber."
Wir sahen uns an.
Er sagte: "Ich möchte nicht, dass du dich mir gegenüber stark fühlen musst, verstehst du?"
"Ich weiß."
"Möchtest du eine Decke?"
"Jess, ich möchte, dass deine Liebe mich trägt, so wie meine Liebe dich tragen kann."
"Nun, alter Mann", sagte er leise.
"Wenn du nichts dagegen hast, schlafe ich bei dir im Bett."
Nachdem ich mich wieder hingelegt hatte, schlief ich bald ein. Während der Nacht wachte ich ein paar Mal auf und wusste nicht, wo ich war, schlief aber jedesmal gleich wieder ein.
In den folgenden Wochen lief alles viel leichter; ich fühlte mich sicher und klar. Zum ersten Mal entfaltete sich der Frühling in mir. Ich schrieb einen Brief an die Rabbinerschule und teilte ihnen mit, dass ich meine Bewerbung zurückziehen und mich melden würde, sobald ich Genaueres wüsste. Obwohl das Semester in sechs Wochen zu Ende war, konnte ich bis zum Ende des Sommers keinen Abschluss machen, und es war unwahrscheinlich, dass die Behörde mich so lange in Ruhe lassen würde.
Immer ist es um sie gegangen. - Und jetzt nimmt sie die Zeitschrift und faltet aus einer Anzeigenseite ein Papierflugzeug. Das ist völlig in Ordnung, niemanden hier interessiert das. Ich wusste, dass es mit ihr nicht leicht sein würde, aber dass es so schwierig werden würde, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte geglaubt, ihr meine Vorstellung dadurch näherbringen zu können, dass ich immer wieder davon erzähle. Witzig, dass es so einfach zu sein schien, denn warum sollte es für sie so viel schwieriger sein als für andere? Am Ende ist es völlig unkompliziert. Das macht es so schwierig.
Es ist gerade fünf Tage her. Ich hatte morgens angerufen und angekündigt, dass ich zum Abendessen kommen würde. Nach vierhundert Meilen im Auto kam ich zu Hause an und alles war wie immer, alles was ich hasste: das enge Glas-Stahl-Gebäude, so glatt und farblos wie die Straßen in Laguna Beach, das kleine Apartment im sechsten Stock, vollgestopft mit französischen Möbeln, im Wohnzimmer das Klappbett, auf dem ich schlief; mein Vater, der kaum richtig da war und sich mehr fürs Fernsehen interessierte; Mutter, die strahlte, als ob es etwas zu feiern gäbe, mit dieser seltsamen Mischung aus Sehnsucht und Gelassenheit in ihren klaren, scharfsichtigen Augen und ihrem königlich-würdevollen Schritt.
Erst einen Monat vorher war ich übers Wochenende dort gewesen. Ich musste lernen, und dieser Besuch war so etwas wie eine ganz normale Überraschung. Ich hielt mich aus der belanglosen Unterhaltung heraus und spürte, dass ich hier nichts Besonderes mehr war. Es war traurig.
Ich wartete bis zum nächsten Nachmittag. Vater war am späten Vormittag aus dem Haus gegangen, und Mutter kam mit frischem Lachs und meinem Lieblingsroggenbrot zurück. Ich sagte: "Ich muss dir etwas sagen", und begann zu erzählen, dass ich mich nicht bei der Einberufungsbehörde gemeldet hatte. Sie runzelte die Stirn und versuchte zu verstehen, was mir Sorgen bereitete.
"Was musst du denn tun?", fragte sie.
"Ich muss nur zur Post gehen und ein Formular ausfüllen."
"Das ist doch nicht so schwer."
"Aber ich hab's nicht getan, woraufhin ich weitere Bescheide von der Einberufungsbehörde bekommen habe, reine Formsache. Aber inzwischen habe ich Post von der Justizbehörde bekommen, und das ist schon ziemlich ernst."
"Inwiefern?"
"Das kommt darauf an. Der Prüfungsausschuss für Kriegsdienstverweigerung meint, dass es wahrscheinlich keine Folgen haben wird. Wir sind nicht im Krieg. Vielleicht überprüfen sie mich und lassen die ganze Sache fallen." Ich sah ihr in die Augen. "Aber ich riskiere, ins Gefängnis zu wandern."
Ihre Lippen zitterten, und sie sagte schnell: "Rickie, wie kannst du es darauf ankommen lassen?"
"Ich will die Herausforderung."
Sie lehnte sich zurück und starrte mich an. "Ich verstehe." Dann stand sie auf und ging in ihr Schlafzimmer. Eine Minute lang saß sie da auf der kleinen gepolsterten Bank bei dem Telefon, während ich mich in dem kleinen, engen Apartment umschaute.
Wegen mir hatte sie unser Haus verkauft, um das Geld für meine Ausbildung aufzubringen. Dieses eingeschränkte Leben, das sie und mein Vater nur von seiner Rente führten, alles wegen mir. Vater hatte für einen Pharmakonzern gearbeitet. Er verbrachte die meiste Zeit in seinem Club, während sie vor allem mit der Wohltätigkeitsarbeit für die Synagogengemeinde beschäftigt war. Ich war natürlich ihr wichtigstes Projekt, sie hatte große Pläne mit mir. Sie kam zurück ins Wohnzimmer. Sie war wütend. "Deine Freunde haben dir das eingeredet. Ich habe diesen Jess getroffen. Er ist so eigenartig und förmlich, und er war ein paar Jahre in Therapie. Er verliert nicht viel, wenn du ins Gefängnis gehst."
"Mutter, hör auf, meine Freunde zu beleidigen. Das ist meine Sache."
"So? Und was ist mit deiner Zukunft? Was ist mit deinen Plänen für die Rabbinerschule? Reicht das nicht, um nicht eingezogen zu werden?"
"Ja."
"Na also …" Da ich nichts sagte, schien sie sich etwas zu beruhigen. "Auf diese Weise kannst du der Welt etwas Gutes tun."
"Mutter, Krieg ist Unrecht." Sie sah mich ungläubig an, und ich wurde ein wenig geduldiger. "Ich habe dir geschrieben wie ich die Dinge sehe. Der Krieg ist einfach kein Weg, um die Probleme zwischen den Menschen zu lösen."
"Aber wir haben keinen Krieg. Du brauchst deine Position nicht zu verteidigen."
"Ich bin aufgefordert, mich zum Wehrdienst zu melden, und ich habe eine Meinung dazu."
"Du sagtest, es sei nur eine Formsache."
"Das reicht aus."
Sie drehte ihren Stuhl weg und bewegte den Kopf hin und her, als hielte sie nach einer einfachen Struktur Ausschau, die plötzlich und unerwartet verschwunden war.
"Wie kannst du sagen, dass Krieg immer Unrecht ist? Ich verstehe ja, dass man Ideale hat, aber schau dir doch die Welt in der wir leben an. Glaubst du, dass es richtig ist, wenn die Kurden vernichtet werden oder Israelis und Palästinenser sich gegenseitig niedermetzeln?"
"Natürlich ist das nicht richtig. Genauso wenig wie die Kämpfe zwischen Briten und Iren oder die Auseinandersetzungen in Afrika. Ich behaupte ja nicht, die Lösung zu haben, aber ich weiß einfach, dass es nicht besser wird, wenn wir noch mehr töten. Die Menschen sind machtgierig und in gewisser Weise von Natur aus hinterlistig und grausam, aber wenn sie anfangen zu morden, dann ist das nicht wieder gut zu machen. Es führt zu Rache und zu noch mehr Mord. Jeder weiß, dass es so ist, aber nur ein paar wenige beziehen wirklich Stellung. Irgendjemand muss den Anfang machen. Wer weiß, für wie gesund man mich hielte, wenn genügend Leute so argumentieren würden."
"Aber das ist nicht der Fall und du bewirkst nichts Gutes. Du wirst dich nur selbst zerstören."
"Mutter, die Welt ist voll von heimatlosen und entwurzelten Menschen. Ich glaube an etwas. Und warum sollte es uns nicht leicht fallen, gut zu sein?" Sie starrte mich verständnislos an. Um sie ein wenig zu besänftigen, fuhr ich fort: "Was ich sage, ist nicht neu, Mutter. Jesus hat im Prinzip dasselbe gemeint, und Einstein hat gesagt, in Friedenszeiten müsse es eine massenhafte Verweigerung des Militärdienstes geben."
Noch immer starrte sie mich an. "Aber wohin führt dich das?"
"Ich fange an, mein Leben zu leben. Darum geht's."
"Was soll das heißen?"
"Ich fange an, für eine bessere Welt zu leben - auf die einzige Art, die mir möglich ist."
Sie saß ganz still, senkte ihren Kopf und begann zu schluchzen. Ich kniete mich vor sie, um sie zu halten, doch sie blieb reglos in meinen Armen und schaute weg.
"Kannst du etwas für mich tun?", fragte sie mit kontrollierter Stimme.
"Was?"
"Sprich mit einem Psychiater darüber."
Ich musste lächeln. "Klingt es so verrückt, wenn einer das Leben schützen will?"
"Ich muss zumindest sicher sein, dass du nicht verrückt bist."
"Natürlich, Mutter." Ich wartete einen Augenblick. "Kein Problem. Natürlich werde ich mit einem Psychiater sprechen. Die Sache ist nur, dass die Regierung aufgrund des Briefes von der Justizbehörde sehr schnell reagieren kann."
"Haben sie um eine Antwort gebeten?"
"Nein. Aber ich habe ihnen trotzdem zurückgeschrieben. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass ich verweigere."
"Ich verstehe", sagte sie und die Reichweite der möglichen Auswirkungen schien ihr bewusst. "Sie könnten an dir ein Exempel statuieren."
"Das nehme ich an."
"Rickie, kannst du nächste Woche zu Hause bleiben? Ich möchte nicht, dass du die Schule verpasst, aber …"
Sie begann wieder zu schluchzen und ich tröstete sie.
"Mutter, die Schule ist doch nicht so wichtig. Du weißt doch, dass ich hervorragende Zeugnisse habe, und was ich verpasse, hole ich im nächsten Semester nach."
Ich war mir über die Zweifelhaftigkeit dieser Aussage im Klaren, denn immerhin war es möglich, dass ich mein Studium für eine ganze Weile nicht würde fortsetzen können. Aber sie glaubte mir. "Du bist noch so jung. Du hast Recht, das sollte kein Problem sein", sagte sie ein wenig beruhigt. Sie schien sich zu freuen, dass wir schließlich doch noch etwas gefunden hatten, worüber wir einer Meinung sein konnten. Doch als ich ihr meine Arme wieder entgegenstreckte, schüttelte sie den Kopf und ging zurück ins Schlafzimmer.
Das Schlimmste schien überstanden zu sein. Da, wo ich nicht taktvoll sein wollte, hatte ich weniger Großzügigkeit von ihr erwartet und angenommen, dass sie viel hysterischer reagieren würde. Jetzt brauchte sie einfach etwas Zeit, um die Nachricht zu verdauen und sie noch einmal von anderer Seite zu hören. Vielleicht konnte ein Arzt ja helfen. Später an diesem Nachmittag ging ich zum Strand, der nur ein paar Straßen von der Wohnung entfernt war, und das beständige Hin und Her der Wellen klang wie ein Echo dessen, was ich zu sagen hatte.
Mit Vater zu reden schien zwecklos zu sein. An diesem Abend blieb ich im Schlafzimmer und las. Ich erfreute mich an Lermontovs äußerst leidenschaftlichem und geschickten Helden Pekorin, während meine Eltern im Wohnzimmer fernsahen. Am nächsten Morgen fing mein Vater von sich aus an. In seinem braunen Seidenmorgenmantel, den er immer nur sonntags trug, kam er ins Wohnzimmer, das dünne, dunkle, leicht ergraute Haar akkurat nach hinten gekämmt, mit einem präzisen Scheitel auf der linken Seite.
"Deine Mutter hat mir von deinen Überlegungen erzählt, Rickie."
"Ja?"
"Es scheint mir riskant zu sein."
"Ja."
"Wohin führt das?"
Seine wie aus dem Nichts auftauchende Beharrlichkeit überraschte mich. "Es erweckt mich zum Leben." Er sah mich auf diese vertraute, fast nichtssagende Art an, aber plötzlich war mir danach, ihm andere und mehr Argumente zu liefern als ihr. "Selbst in Friedenszeiten wie jetzt sind wir unentwegt damit beschäftigt, den Krieg zu planen; als ob wir uns dadurch nicht schuldig machen würden. Aber genau das tun wir. Wenn es um das Leben anderer Menschen geht, kann man nicht unbeteiligt bleiben. Es geht aber um das Leben anderer Menschen. Es ist verrückt zu töten, denn es führt zu Rache und Zorn und noch mehr Tod. Oder es lässt einen verrückt werden vor Schuldgefühlen. In dem Moment nämlich, wo man sich zu einem Teil der Tötungsmaschinerie macht, lädt man wirkliche Schuld auf sich."
Doch da sein ausdrucksloser Blick sich nicht veränderte, wusste ich, dass ich wieder zu weit gegangen war. Wie kommt es, dass ich das immer wieder vergesse? Er schüttelte den Kopf, als ob er sich selbst wachrütteln wollte und sagte: "Aber wie deine Mutter sagt, ist es sehr hinderlich für dich."
"Wir werden sehen."
"An deiner Stelle würde ich es noch einmal überdenken."
Ich wusste nicht, ob ich gerührt war. Er saß in dem Sessel am Fenster, dieser seltsam neutral wirkende Mann, bequem zurückgelehnt mit übereinander geschlagenen Beinen. Er hätte ebenso gut in einem Schaukelstuhl auf einer Veranda sitzen und zusehen können, wie auf der anderen Straßenseite ein Haus abbrennt; vielleicht würde er ein wenig blinzeln, weil das Feuer so hell loderte, aber dann würde er seine Augen wieder schließen, um sich zu entspannen. Er hatte diese merkwürdig anästhetische Art, und zwar mit aller Konsequenz. Ich antwortete: "Ich weiß, dass du das tun würdest."
Als er sich abwandte, nachdem er seine Pflicht erfüllt hatte, konnte ich dennoch nicht ganz aufhören. "Wie glaubst du hängt das zusammen? Es heißt: ›Du lässt deine Schafe sicher weiden‹ und gleichzeitig werden für dein Abendessen Lämmer geschlachtet?"
"Ich kann dir nicht folgen."
"Es kam mir nur so in den Sinn."
Am Nachmittag traf ich meine Tante und meinen Onkel. Selma umarmte mich, und ihre leuchtenden Augen strahlten dieselbe Wärme aus wie immer. "Oh, Rickie, so ein Mist. Ist das denn die Möglichkeit?" Sie war die einzige, die die Frage offen ließ. Len sah besorgt aus, fast verärgert. Er verfiel in diesen dozierenden, juristischen Ton, während die anderen in der anderen Ecke des Zimmers saßen und so taten, als bekämen sie nur zufällig etwas mit.
"Rickie, niemand verlangt von dir zu kämpfen. Du wirst nicht eingezogen, und wir haben keinen Krieg."
"Man verlangt von mir, dass ich mich jetzt schon für den nächsten Krieg melde."
"Wir wissen nicht einmal, ob es einen nächsten Krieg geben wird."
"In diesem Fall wäre meine Verweigerung ein zukunftsweisender Schritt." Doch ich spürte, dass mein Sarkasmus ein Schlag unter die Gürtellinie war, und Len ist ein intelligenter Mann.
"Verstehst du denn nicht? Dieser Frieden ist ein Scheinfrieden! Wir sind bereit zu kämpfen. Wir ergötzen uns an Streitkräften und Waffensystemen. Wir sehen im Fernsehen Flugzeuge, die zwölftausend Kilometer von hier blankpolierte Bomben abwerfen. Wir hören, dass zehntausend Zivilisten unbemerkt sterben mussten und bleiben völlig teilnahmslos. Das ist nicht weniger grässlich als der Krieg selbst. Ich will auf das Problem hinweisen, weil es so aussieht, als ob es keines wäre. Und wenn ich dafür ins Gefängnis gehe, macht das nur deutlich, wie wenig dieses Land ein Problem darin sieht."
"Was, wenn die Israelis und die Palästinenser UN-Friedenstruppen akzeptieren würden? Man kann niemanden in eine Friedensmission schicken, ohne ihn vorher einzuziehen."
"Man könnte Freiwillige schicken, die sich für den Frieden einsetzen wollen. Das würde ich tun." Er schaute mich an, als hätte ich noch nie so verrückt ausgesehen wie in diesem Moment, aber ich fühlte mich sicher genug eine Schwäche einzugestehen. "Mir ist klar, dass ich nicht jeden möglichen Fall durchdacht habe. Es geht mir um das Prinzip, nämlich keinen Krieg zu unterstützen, in keiner Weise."
Len hielt einen Moment inne und versuchte so ruhig wie möglich zu bleiben. "Aber wer gewinnt dabei? Selbst wenn deine Prinzipien richtig sind, wem ist mit deinem Verhalten gedient?" Er schüttelte den Kopf. Ohne eine Antwort abzuwarten sprach er weiter. "Es gibt so viele Möglichkeiten, der Welt einen Dienst zu erweisen, hier in Watts oder im Osten von Los Angeles oder im Friedenscorps."
Ich nickte. "Aber das hat nichts mit den Tatsachen zu tun, von denen ich spreche."
"Tatsache ist, dass du deine Familie unglücklich machst."
"Das ist nicht meine Absicht."
"Warum bestehst du dann darauf - und warum auf diese willkürliche Art und Weise?"
Er hatte mich nicht verstanden. Mit ruhiger Stimme sagte ich: "Weil mich die Regierung dazu auffordert?"
"Gibt es irgendjemanden, dem du damit hilfst?"
"Das würde ich gerne herausfinden." Len schaute mich an, als hätte er noch mehr zu sagen, aber jetzt wollte ich weiterreden. "In Sierra Leone und Mozambique werden siebenjährige Kinder zum Militär eingezogen. Hungernde und obdachlose Jugendliche melden sich freiwillig, weil sie keinen anderen Weg sehen. Ich bin zumindest alt genug um zu sehen, dass es andere und bessere Wege gibt, und deshalb sage ich ein entschiedenes Nein!"
"Nichts siehst du besser, du siehst es lediglich ein bisschen anders. Und ich sage dir: du hilfst niemandem! Du tust es aus purem Egoismus!" Seine Stimme war wieder härter geworden, und schneller als ich gehofft hatte, verließ er das Zimmer. Die anderen folgten ihm. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück.
Nur Selma drehte sich an der Tür noch einmal um, fuhr mit der Hand zum Mund und warf mir einen Kuss zu. Das werde ich niemals vergessen.
Nichts von alledem hätte vermieden werden können und mir war klar, dass ich es herausgefordert hatte. Dennoch fiel es schwer, die ungeheure Ironie zu ertragen, die mich zum Mörder im eigenen Hause machen wollte. Nein, das wäre zu hart formuliert, aber meine Familie und ich standen uns zum ersten Mal als Feinde gegenüber, und das wollte ich nicht, mit keinem von ihnen.
Als Len und Selma gingen, schüttelte er meine Hand mit einem entschlossenen Lächeln auf dem Gesicht und sagte: "Ich sollte nicht so wütend mit dir umgehen, Rickie", aber seine Freundlichkeit wirkte befremdlich. Er klang, als hätte er es mit einem Geisteskranken zu tun. Vielleicht, dachte ich, würde das Zugeständnis helfen, mit einem Psychiater zu reden. Einer ihrer Freunde aus der Synagoge kannte diesen Dr. Arcati auf der Magnolia Street, der sich mit Einberufungsfragen auskannte, und Mutter hatte bereits etwas arrangiert.
Und tatsächlich konnte er - ich denke, das ist das richtige Wort - helfen.
Ich musste nicht lange auf ihn warten, eine knappe Viertelstunde. Als ich das Sprechzimmer betrat, saß er an seinem Schreibtisch, ein kräftiger Mann mit buschigen Augenbrauen und schnellen, zackigen Bewegungen, die streng gewirkt hätten, wären sie nicht so verkrampft ausgefallen. Sie hatte bereits mit ihm gesprochen und saß seitlich vom Schreibtisch, den Kopf nach vorn gebeugt.
"Ich verstehe deine Überzeugungen", begann er, und sein Oberkörper drehte sich hastig hin und her. "Und du hast ein Recht, deine Meinung öffentlich zu äußern. Wenn du dich beim Militär meldest, und dazu brauchst du ja nur ein Formular auszufüllen, wie wenn du ein Auto anmeldest, - das hast du doch schon mal gemacht, nicht wahr? - wenn du dich meldest, kannst du einen persönlichen Brief dazu legen, und ich werde eine Stellungnahme über unser Gespräch beifügen."
Er sprach so schnell, dass ich ihn mitten im Satz unterbrechen musste. "Aber ich habe bereits verweigert und ich habe bereits einen Brief geschrieben."
"Das ist auch in Ordnung. Dann kommt mein Kommentar in deine Akte."
"Was für ein Kommentar?"
"Du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen."
"Ich mache mir keine Sorgen, es interessiert mich einfach."
"Du bist ein introvertierter junger Mann", sagte Dr. Arcati nach einem kurzen Moment. "In der Uni bist du deinen Kommilitonen um Jahre voraus, und jetzt übertriffst du dich selbst im Leben. Dafür haben wir Fachausdrücke, die dir helfen könnten."
Ich sah sie an; sie sah nach unten. "Ich dachte, daß wir darüber sprechen", sagte ich.
"Ich weiß, daß du deine Prinzipien hast", antwortete Arcati. "Und die stehen auch nicht in Frage. Eigentlich möchte ich dir dabei helfen, sie zu bewahren."
"Was soll das heißen?"
"Es geht hier um unmittelbare Konsequenzen."
"Aber genau das ist es ja. Ich trete für meine Überzeugung ein", sagte ich. Offensichtlich hatte Mutter meine Lage ganz falsch dargelegt. "Das hier ist nicht bloß eine Geste. Mein Verhalten zwingt die Regierung zum Handeln."
Der Doktor setzte sich gerade hin. "Ich rede mit dir aus einem reichen Erfahrungsschatz heraus", sagte er mit etwas lauterer Stimme. "Natürlich kannst du dich verhalten wie immer du willst, aber sehr wahrscheinlich wird nichts dabei herumkommen. Die meisten Richter werden sich die Sache anhören und es mit einer Bewährungsstrafe gut sein lassen. Aber wenn du Pech hast, gehst du ins Gefängnis. Und ich verspreche dir: das hältst du keine vier Wochen aus. Ein zurückhaltender, gutaussehender junger Mann wie du. Die werden dich fertigmachen." Er lachte plötzlich, fing an, sich wieder zu drehen, sah zwischen ihr und mir hin und her und schlug mit beiden Händen auf den Tisch. "Ich schreibe einen Brief für dich, und die Sache ist erledigt."
Ich stand auf und verließ den Raum. Der Verkehr auf der Straße lief ruhig und geordnet, und in diesem Moment kam mir das alles weit weg vor.
Mit einem Mal war sie wieder da. "Rickie", sagte sie sanft, und nahm meinen Arm.
Ich spürte, dass sie von diesem Doktor nicht weniger missbraucht worden war als ich. Dennoch wollte ich mich ganz unmissverständlich ausdrücken. "Ich will keinen Brief von diesem Mann."
"Er hatte Unrecht", flüsterte sie.
Eilig gingen wir zurück zu ihrer Wohnung auf der Cedar Street, wo ich sie allein ließ. Einerseits hatte uns dieser gammelige Typ zusammengebracht, andererseits aber war ich noch einsamer und ziemlich am Ende. Ich dachte, dass mir ein Spaziergang am Strand gut tun würde. Die ausgemergelten Palmen, der Sand, der jetzt am frühen Abend angenehm kühl war, das regelmäßige Anrollen der Wellen, die keinen guten Willen kannten und denen all das gleichgültig war. Eine Stunde wanderte ich am Wasser entlang, und es kam mir vor wie ein Augenblick. Doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wurde stärker.
Ich stieg in den Wagen und fuhr auf die Autobahn Richtung Hollywood, zur La Habra Street, wo wir uns früher nach der Highschool gerne herumgetrieben hatten.
Es war noch genau wie damals. Kleine Gruppen von Seglern, Mädchen in hochhackigen Schuhen und Miniröcken, Polizisten, die in Eingängen herumstanden, Türsteherinnen, die jetzt am frühen Abend, wenn die Beleuchtungen nach und nach eingeschaltet wurden, in Ruhe ihre Shows ankündigten und den Männern sensationelle Vorstellungen versprachen. Als ich noch jünger war, kam ich natürlich nie weiter als bis zur Tür, aber jetzt wirkte das alles ganz anders als in meiner Erinnerung. Es gab eine Grenze zu überschreiten, und mir wurde klar, warum ich hier war. Es ging um dieses Verlangen nach Farbe, nach etwas Buntem, das es eigentlich gar nicht gab. So kurz vor dem Ziel wurde das Verlangen immer stärker.
Ich ging in eine Bar, setzte mich an die Theke, bestellte ein Käsesandwich und trank ein dünnes Bier und einen bitteren Kaffee. Nach einer Weile ging ich nach nebenan in das Theater, dessen Leuchtreklame "Hier sehen sie alles" mir schon draußen auf der Straße aufgefallen war. Auf dem Plakat am Eingang stand: 5 Dollar - 10 Minuten. Ein Mann, der in einem kleinen Häuschen saß und in einer Zeitschrift las, verkaufte mir eine Karte ohne dabei aufzuschauen.
Es war ein Theater, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Ein großes Fenster bildete den Abschluss einer abschüssigen Fläche, auf der die Zuschauer Platz hatten. Auf dieser Plattform waren Trennwände installiert, die sowohl den Raum vor als auch hinter der Glasscheibe teilten, so dass jeder Kunde für sich stand, nur ein paar Zentimeter von der Scheibe entfernt. An der Oberseite des Fensters war eine Begrenzung aus schwarzem Plastik angebracht, so dass man unmittelbar vor sich durch eine Art rechteckigen Fensterausschnitt guckte, während weiter hinten das höhere Ende der Plattform zu sehen war. Zunächst war dieser Raum leer, doch dann tauchte aus einem kleinen Seiteneingang eine schlanke, dunkelhaarige Frau auf, nackt und mit weit geöffneten Augen, die eine wunderbare Gleichgültigkeit ausstrahlten. Sie ging auf der oberen Plattform hin und her und blickte auf ihre kleinen, wohlgeformten Brüste und ihren großen, fast eiförmigen Po. Dann bewegte sie sich in lässigen Zickzackschritten nach vorne und verschwand hinter der rechts von mir liegenden Abtrennung. Ich wartete über eine Minute und fragte mich, ob das eine Art Trick war und die Show bereits aufhörte, bevor sie eigentlich richtig angefangen hatte.
Doch plötzlich tauchte sie genau vor meiner Nase wieder auf, besser gesagt ihr Unterkörper, denn das war alles, was ich sehen konnte. In langsam kreisenden Bewegungen presste sie ihren Schritt gegen das Glas, schwang sich herum, beugte sich zurück und spreizte ihre Beine, so dass die rundliche Spalte vollkommen freilag. Dann drehte sie sich wieder um und stieß ein paar Mal feste gegen das Glas. Vom oberen Rand fiel ein Vorhang. Wieder wartete ich eine Minute und versuchte, mich an das Gesehene zu erinnern. Diese Frau schien dafür bezahlt zu werden, dass man sie vergaß und an … ja an was eigentlich dachte? An die versteckte, dunkle Öffnung eines Seesterns vielleicht, oder an einen Tintenfisch?
Anfangs war ich entschlossen, für weitere zehn Minuten zu bezahlen, entschied mich dann aber doch zu gehen. Ein kleiner junger Mann mit einem Schnäuzer, der mit mir zusammen das Theater verließ, meinte grinsend: "Ich habe meine Hand oben ans Fenster gehalten und sie ist gesprungen." Er zeigte mir seine rechte Hand, die immer noch klebrig war. Ohne zu wissen warum, grinste ich zurück und ging fort.
Eine Stimme in mir sagte wie zum Trost: "Jetzt habe ich bewiesen, dass es nicht funktioniert." Ich zitterte ein wenig und spürte doch ein ungestilltes Verlangen.
Vor mir ging eine junge schwarze Frau. An der nächsten Ecke bog sie rechts ab in die Viejo Street, und ich folgte ihr. Das hier war nicht arrangiert wie die Show hinter Glas. Wir gingen an Secondhand Möbellagern vorbei, an Steuerbüros und schäbigen Apartments, und ich hörte sie alle wie im Chor: "Bleib dran Junge, laß nicht locker." Doch ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, wenn sie mich sehen würde. Ich war mir nicht einmal sicher, ob sie mich nicht schon gesehen hatte. (Sie hatte einen Schlüssel fallengelassen und einen Moment angehalten, um ihn wieder aufzuheben.)
Wenn ich nur etwas gehabt hätte, was ich ihr hätte geben können. Eine Rose vielleicht! An der nächsten Kreuzung blieb sie stehen und wartete, bis sie über die Straße konnte; ich hielt mich hinter ihr. Eine Straße weiter, Ecke LeDroit Street, holte ich sie ein.
"Hallo", sagte ich und meine Stimme kam von so weit weg, dass ich mich selbst kaum hören konnte.
Sie hatte ein sehr zartes Gesicht; aber sie funkelte mich mit zusammengezogenen, verrauchten Augen an, als ob sie mich tatsächlich die ganze Zeit gehört und ihre Antwort bereits parat hatte. "Ich will nicht." Sie spuckte es geradezu heraus, drehte sich wieder um und überquerte die Straße.
Ich dachte: Es war ein Versuch. Vielleicht arbeitet sie ja auch in einer dieser Shows. Aber es kränkte mich mehr, als ich erwartet hatte.
Als ich nach Hause kam, packte ich meine Sachen und die Wäsche, die Mutter für mich gebügelt hatte. Das war auch so etwas; ich wollte meine Wäsche nicht mehr nach Hause bringen, aber darüber brauchten wir jetzt nicht zu reden. Ich begann, mich wieder stärker zu fühlen, stärker sogar, als ich mich in Berkeley gefühlt hatte. Mir war klar, dass ich mein Leben wieder in die Hand nehmen und abwarten musste, was passierte. Mir war klar, dass ich mich selbst öffnen musste, und nicht nur einem einzigen Menschen gegenüber. Es gab Wichtigeres. Was Mutter betraf, hatte ich getan was ich konnte, und unser Verhältnis war ja nicht wirklich zerstört.
Als ich an diesem Morgen aufwachte, saß sie am Fußende meines Bettes.
"Du bist so spät nach Hause gekommen", sagte sie freundlich und ohne Druck in der Stimme. Sie klang wie zu unseren besten Zeiten. "Hast du gut geschlafen?"
"Mhm."
"Wie ich sehe, hast du deine Sachen gepackt."
"Ich fahre heute zurück zur Uni."
"Es ist klar, dass wir mit diesem Mann nicht weiterkommen, Lieber. Ich habe mit Mrs. Haskell telefoniert. Erinnerst du dich an sie? Sie ist Psychologin." Ich schüttelte den Kopf. "Sie meint auch, dass er der Falsche war." Wieder machte sie eine kleine Pause. "Sie meint, du klängst unsicher."
Ich lächelte. "Mutter, verlange nach diesem Auftritt gestern bitte nicht von mir, dass ich mich hinter irgendeiner Geisteskrankheit verstecke."
"Das tue ich ja auch nicht. Aber sie empfiehlt, dass du einen Test machst. Das kann doch nicht schaden, oder? Rickie, ich brauche etwas. Etwas, das für uns beide stimmt, bevor ich dich diesen Schritt tun lassen kann."
"Was ist das für ein Test?"
"Sie kennt einen guten Psychologen in Santa Monica. - Er arbeitet in einer Klinik namens Greenacres. Es soll dort sehr schön sein; eine alte Villa mit Park, die zu einer modernen Klinik umgebaut wurde. Sie könnten einen Test mit dir machen. Das dauert vielleicht zwei, drei Stunden. - Ich werde auch befragt."
Ich traute meinen Ohren nicht. "Ist das dein Ernst? Ich soll in eine psychiatrische Klinik?"
"Doch nur, weil der Psychologe dort arbeitet. Gerade eben, bevor du aufgewacht bist, habe ich angerufen. Du könntest heute hinfahren. Es liegt mir wirklich sehr viel daran."
Sie war tatsächlich ruhiger und gefasster geworden, seit sie das erste Mal von meiner Absicht gehört hatte. Ich spürte ihren Wunsch die Feindschaft, die zwischen uns Platz gefunden hatte, zu überwinden und für einen Augenblick blieb ich still, weil ich spürte, wie gut ihr das tat.
Es war so ähnlich wie damals auf der Highschool, als ich mit ihr in diese komischen Musicalfilme ging, die sie so mochte. Mir gefielen sie nicht, ich tat es wegen ihr. Sie sprach weiter: "Du hast doch gesagt, du könntest den Rest der Woche frei nehmen."
"Zwei, drei Stunden?", wiederholte ich.
"Ja."
"Warum nicht in zwei Wochen oder in einem Monat, nach meinem Examen?"
"Du hast gesagt, die Justizbehörde kann jederzeit reagieren."
Das stimmte. Es stimmte auch, dass ich sehr schnell gewesen war. Es brauchte nicht viel Zeit, ihr diesen Gefallen zu tun. Sie wünschte es sich so sehr und mir machte es nichts aus.
Da der Psychologe ihr auch einige Fragen stellen will, habe ich darauf bestanden, dass wir zusammen fahren. Es kostet mich zwei Stunden, aber ich kann ja auch heute Abend noch zur Uni zurückfahren. Wie sie jetzt starrt! Während der letzten Woche ist sie noch verkrampfter geworden. Ihr tut es gut, wenn ich ein bisschen nachgebe, und mir tut es gut etwas langsamer zu werden. Ein Test - was immer das heißen mag. Schnelligkeit und Organisation des Denkens, geistige Klarheit, das sollte ja wohl eine Kleinigkeit sein. Dieses elegante Gebäude mit seinen Säulengängen, viel zu kunstvoll für eine normale Praxis; hatte man das aus England importiert? Es ist der richtige Ort für unseren letzten gemeinsamen Schritt. Es hat etwas Franziskanisches, den Wohlstand der eigenen Familie hinter sich zu lassen.
Eine hochgewachsene schwarze Frau in einem hellgrünen Kleid kommt herein, lächelt mich an und zwinkert meiner Mutter zu. "Rose Adler", sagt Mutter.
Ich lächle zurück und für einen langen Augenblick wendet sich die Frau wieder mir zu. "Ich bin Robin DeWitt", sagt sie und streckt mir ihre Hand entgegen. Fast fühlt es sich an wie ein Zeichen der Beruhigung. "Ich freue mich auf unser Gespräch."
Die beiden verlassen das Wartezimmer.
Leseprobe 3: Kapitel 2: Die nächsten fünfzig Minuten
Man hatte mir nicht gesagt, dass ich mit einer Frau sprechen würde. Sie sieht gut aus. Warten, nur leeres, ruhiges Warten, fünf Minuten, zehn Minuten; auch die malerischen Fotos im National Geographic lassen die Zeit nicht schneller vergehen. Ein Mann kommt herein und bleibt im Eingang stehen, als ob auch er zum ersten Mal hier wäre und warten müsste, doch dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. "Dr. Heaver", er gibt mir die Hand und ich folge ihm durch den Flur in ein kleines, freundliches Büro mit hellgrauer Tapete, auf die dezente chinesische Landschaftsmotive gedruckt sind. Ein ziemlich klein geratener Arzt. Irgendwie ähnelt er dem jungen Mann mit den klebrigen Fingern von letzter Nacht. Ein unangenehmes Gefühl. Völlig abgeklärt sitzt er an seinem Teakholztisch, die Finger hinter dem Kopf verschränkt.
"Du fängst an", sagt er.
"Ich dachte, die Frau, die meine Mutter geholt hat, käme zurück."
"Oh, ja."
"Sollen Sie mich testen?"
Er nickt. "Ja, ich mache die ersten Tests."
"Wie meinen Sie das?"
"Kannst du mir nicht zuerst etwas über dich und deine Einstellung erzählen?"
"Sie meinen meine Einstellung zum Krieg?"
"Ja."
Eigentlich macht er einen ganz interessierten Eindruck. Aber ich versuche vorsichtig zu sein.
"Was möchten Sie wissen?"
"Nun, zum Beispiel seit wann du so denkst."
"So etwas fängt nicht irgendwann an."
"Oh!"
"Ich meine, nicht zeitlich." Ich warte einen Moment. "Es beginnt an der Stelle, wo es immer schon war."
"Ich verstehe. Taucht es als eine Art Vision auf?"
"In gewissem Sinne. Meinen Sie unabhängig von Gefühlen oder Gedanken?"
"Ja, zum Beispiel."
"Nein. Ich spreche von einer wirklichen Erkenntnis. - Wissen Sie, ich war nicht darauf vorbereitet, über diese Dinge zu sprechen. Eigentlich sollten hier meine geistigen Fähigkeiten getestet werden."
"Ja, aber ich würde mir gerne einen Eindruck davon machen, was dich beschäftigt."
Wieder klingt er sehr interessiert. "Im Augenblick beschäftigt mich vor allem die Verzweiflung meiner Mutter."
"Inwiefern?"
"Ich muss lernen damit zu leben, und das ist nicht einfach. Obwohl es ein bisschen leichter geworden ist." Plötzlich erzähle ich von der letzten Woche, von den Schwierigkeiten mit meiner Familie, Dinge, die ich dem anderen Arzt gegenüber nicht erwähnt habe, und berichte sogar über meine Begegnung mit diesem verrückten Kerl.
"Und doch gibt es da einen Bruch", fügt Dr. Heaver am Ende hinzu.
"Ja." Aber ich merke, dass ich wieder den Faden verliere.
"Bitte, darum geht es doch jetzt gar nicht."
"Vielleicht doch", sagt er. "Wir werden uns auch ein Bild davon machen, wie deine Mutter die Dinge sieht."
Sein "wir" lässt mich aufschrecken, es klingt beängstigend. Ich sehe mich im Zimmer um. Wie komme ich hier wieder heraus? Dr. Heaver, der einen ziemlich entspannten Eindruck macht, schaut mich wissend an.
"Ich nehme an, du willst ihr nicht helfen, aus ihrer Verzweiflung herauszukommen."
"Natürlich will ich das. Deswegen bin ich ja hier."
"Und dein Vater?"
"Was?"
"Er hält sich ziemlich im Hintergrund, jedenfalls nach allem, was ich gehört habe."
"Das stimmt allerdings."
Er wartet einen Augenblick. "Mit dir, mit deiner Mutter, um die du dich sehr sorgst."
"Was meinen Sie?"
"Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klingt ein bisschen deprimiert, auch die ›wirkliche Erkenntnis‹, von der du sprichst. Zu Hause fragst du dich wahrscheinlich manchmal, wofür das alles gut sein soll."
Ich stehe auf und will gehen. "Wenn wir jetzt nicht diesen Test machen, sehe ich keinen Grund, länger zu bleiben …"
"Du willst nicht weiterreden, ich verstehe."
"Gut."
Sein Telefon klingelt. Er winkt entschuldigend, sagt ein paar Mal "Ja, ja", und dann: "Nein, Dr. Tempel ist nicht hier. Er ist auf der Richtlinienkonferenz des Klinikverbandes. Ja. Routine. Kann ich Sie in einer Stunde zurückrufen?" Ich frage mich, wozu er eine ganze Stunde braucht. Will er auch mit meiner Mutter reden, oder hat er etwas anderes vor, das nichts mit mir zu tun hat? Andererseits sieht es so aus, als ob ich im Augenblick sein wichtigstes Projekt wäre.
Er wendet sich mir wieder zu, und ich sage: "Ich will Sie nicht aufhalten."
"Du hältst mich nicht auf."
"Also, ich nehme an, Sie verstehen, dass es hier eine gewisse Dringlichkeit gibt."
"Kannst du mir mehr über diese Dringlichkeit sagen?"
"Soll das ein Witz sein? Es gibt hier eine ganz bestimmte Sache zu erledigen, und zwar diesen Test. Das bin ich ihr schuldig." Sein neugieriger Blick macht mir plötzlich bewusst, dass ich mehr sage, als ich eigentlich will. Er hat etwas von diesem Arcati, ist dabei aber sehr viel feinsinniger. Es fällt mir schwer nicht weiterzureden. "Wenn Sie nicht aufpassen, wird sich am Ende noch jemand totlachen. Das ist auch eine Art jemanden umzubringen. Es wird kühl hier."
Ich unterbreche mich selbst und er antwortet sofort. "Wir versuchen die Temperatur so angenehm wie möglich zu halten. Nein, ich meine es ernst. Du möchtest ihr helfen."
Einen Moment lang sitzen wir schweigend da. "Ich kann dich beim Wort nehmen."
"Natürlich können Sie das."
"Gut, dann hören wir jetzt damit auf."
Ich will nicht wieder abschweifen. "Wer macht die Tests mit mir?"
"Das macht Dr. Nickols. Du wirst sie mögen."
"Also nicht Mrs. DeWitt?"
"Nein." Er scheint sich zu wundern, daß ich den Namen erwähne.
"Sie kam ins Wartezimmer", sage ich.
"Oh, ja."
"Dass ich sie mag, weiß ich."
"Gut." Also gehe ich zu einer anderen. Aber warum?
"Und dann möchte ich dich Dr. Tempel vorstellen."
"Wer ist das?"
"Alan Tempel", sagt er beiläufig. "Der Direktor der Klinik."
"Ich dachte, der wäre auf einer Konferenz."
"Nein, nein, er wird bald zurück sein." Während er redet, drückt er auf einen Knopf an seinem Schreibtisch, woraufhin eine Frau mit faltigem Gesicht hereinkommt. Sie trägt ein weißes Kleid, offenbar eine Krankenschwester.
"Mrs. Hauldron, das ist Richard Adler." Sie reicht mir ihre Hand und lächelt herzlich. "Er ist hier, um ein paar Tests zu machen. Würden Sie ihn bitte auf 4W begleiten."
Sie nickt. Dr. Heaver steht auf, und als ich ihn fragend ansehe, sagt er: "Später werden wir uns weiter unterhalten." Ich folge Mrs. Hauldron, die mich forschen Schrittes in das gegenüberliegende Zimmer führt. Hinter uns fällt die Tür mit einem Klick ins Schloss, sicher um Dr. Heavers Privatsphäre zu schützen, und wir gehen eilig durch eine schmale Halle, an deren Wand eine geschnitzte, mit Perlmuttintarsien versehene Truhe steht. An der Tür am Ende des Ganges bleibt Mrs. Hauldron einen Augenblick stehen, und erst als wir die Tür hinter uns haben und ich höre, wie das Schloss in der Tür zuschnappt, bemerke ich, dass sie durch geschickte Bewegungen einen Schlüssel in ihrer Hand verbirgt. Wahrscheinlich hat sie eine Menge Erfahrung damit.
Nun stehen wir in einem Flur, auf dessen linker Seite die Patientenzimmer liegen. An einem schmalen Absatz auf der rechten Seite befinden sich zwei offene Räume. Vielleicht werden hier die Tests durchgeführt. Aber sie wendet sich nach links, wartet einen Moment, führt mich durch die Tür und schließt wieder diskret hinter uns ab. Ich stehe in einem langen Korridor, von dem links und rechts leere Zimmer abgehen, wie in einem Hotel.
"Ich bringe Sie hier herein", sagt sie freundlich und führt mich in ein Zimmer mit frisch bezogenem Bett, einem Stuhl unter dem Fenster und einem kleinen Schreibtisch.
"Wo bin ich hier?"
"Mein Gott, entschuldigen Sie bitte. Ich dachte, Dr. Heaver hätte es Ihnen gesagt, aber wahrscheinlich hatten Sie beide Wichtigeres zu besprechen. Das hier ist unser Aufnahmezimmer. Die anderen Patienten sind im Augenblick alle draußen, aber bevor sie zu ihnen können, müssen wir noch die Aufnahmeformalitäten erledigen."
"Ich bin hier, um mit Dr. Nickols zu sprechen." Plötzlich klingen meine Worte irgendwie mechanisch.
"Natürlich, das auch. Es tut mir Leid, wenn das im Augenblick etwas langweilig für Sie ist, aber es wird nicht lange dauern." Sie lächelt mich mit leicht besorgtem Ausdruck an. "Das Letzte, was wir wollen, ist, dass Sie sich hier langweilen."
Verdutzt schaue ich sie an. "Ich möchte mit meiner Mutter sprechen." Meine Stimme ist sehr leise, und als ob das alles erklären könnte, füge ich hinzu: "Wir sind zusammen gekommen."
"Machen Sie sich keine Sorgen, Richard, Sie werden mit Ihrer Mutter sprechen. Ihre Interessen werden in keiner Weise übergangen. Ich muss jetzt gehen", sagt sie noch, und immer noch fassungslos starre ich sie an.
Ich setze mich auf den Stuhl am Fenster und schaue hinaus auf die Pappeln, die sich satt im Wind wiegen. Ich versuche, das Fenster zu öffnen, um das Rauschen zu hören, aber das Fenster lässt sich nur einen Spaltbreit öffnen. Ich schließe die Augen und spüre Tränen aufsteigen; ich stehe auf und gehe hinaus, gehe den Flur auf und ab, bis zu der verschlossenen Türe und zurück zum Zimmer - wie ein Besucher, der sich orientieren und ein Gefühl für die Räumlichkeiten bekommen will. Doch auf einmal wird mir klar, dass ich mir nur wie ein Besucher vorkomme.
Was war ich doch bloß für ein Idiot! Diese Frau war eine Krankenschwester. Natürlich hätte sie mich zu einem Psychologen bringen können - wenn das alles nicht eine Falle gewesen wäre. Mrs. DeWitt war ja eigentlich sehr nett, aber dieser schleimige Kerl, warum habe ich ihn nicht einfach sitzen gelassen. Wieder gehe ich im Flur auf und ab, schneller als vorhin; mein Hals schnürt sich zu, auf und ab und wieder zurück ins Zimmer, mit dem Rücken zur Tür. Schritte. Ich drehe mich um und sehe in das Gesicht meiner Mutter.
"Hol mich hier raus!"
"Ich weiß, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt hatten." Sie zittert ein wenig und versucht, ihre Stimme zu kontrollieren.
"Du hast es gewusst!"
"Ich war mir nicht sicher." Ich hebe meine Arme, die Fäuste geballt, und ihre Festigkeit löst sich in nichts auf. "Rickie", flüstert sie: "was hätte ich denn tun sollen?"
"Du hast mich angelogen!"
"Ich habe erwartet, dass du so reagieren würdest." Meine Wut hilft ihr, sich wieder zu fassen.
"Oh, ich verstehe. Da draußen haben sie dich genau darauf vorbereitet, was du sagen sollst."
"Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit dir allein sprechen will." Ich warte - ein kurzes Schweigen. "Ich möchte, dass du so lange hier bleibst, bis sie mehr sagen können."
"Hier bleiben …?"
"Eine Woche vielleicht, oder zwei." Ich schaue sie voller Entsetzen an, und ihre Stimme bricht wieder. "Rickie, das alles gehört zu einer Untersuchung dazu. Du wirst einfach beobachtet."
"Raus!" Ich brülle sie an. "Du bist nicht meine Mutter!"
Sie schnappt nach Luft, verlässt das Zimmer und läuft zur Schwester, die am Ende des Gangs auf sie wartet, um sie rauszulassen. Ich verlasse das Zimmer und ermesse zum ersten Mal die ganze Länge des Flures. Am anderen Ende befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit Sesseln und Fernseher. Von dort aus kommt man in den Garten. Ich versuche die Tür zu öffnen, aber auch die ist natürlich abgeschlossen. Ich war bereit dem Leben zu dienen, war bereit meine Freiheit zu opfern; aber von einem Tag auf den anderen, ja innerhalb einer Stunde zum Gefangenen zu werden, das ist zu lächerlich, das ist wirklich verrückt.
Oder habe ich mir einfach nicht vorstellen können, dass es zu so einer Inhaftierung kommen könnte, weil ich dachte, das alles läge noch in weiter Ferne?
Eine Gruppe von acht Männern, alle sehr still und älter als ich, kommt mit einem Wärter herein. Ohne mich auch nur irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, verschwinden sie wie Geister in ihren Zimmern. Ich gehe ebenfalls in mein Zimmer zurück - für den Augenblick ist es ›meins‹ - und setze mich wieder ans Fenster. Im Augenblick bin ich etwas ruhiger und betrachte den Tag aus einer anderen Perspektive. Irgendwie sah sie schon im Auto so unnachgiebig aus. Sie hatte das Bild bereits vor Augen. Sie muss es von Anfang an gewusst haben. Andererseits hatte sie keine Wahl. Sie müssen ihr eingeredet haben, wovon sie mich dann überzeugen wollte, nämlich dass das alles zum ›Testverfahren‹ dazugehört. Und nachdem sie erfuhren, dass ich nicht freiwillig dableiben würde, haben sie ihr wahrscheinlich erzählt, was sie sagen soll. Und dann hat sie womöglich der Anblick dieser herrschaftlichen Villa noch beruhigt, wo alles so geschmackvoll und kultiviert aussieht.
Die "Humanistische Psychologie" mit ihrem Respekt vor dem inneren Leben! Dr. Arcati war einfach ein schlechter Scherz gewesen. Aber betrogen wird auch hier, nur sehr viel raffinierter. Derselbe schlechte Scherz - nur mit schärferen Zähnen.
Ist diese Inhaftierung überhaupt legal? Kann man gegen seinen Willen festgehalten werden, wenn kein Verstoß gegen das Gesetz vorliegt und man für niemanden eine Gefahr darstellt? Anscheinend wissen diese Ärzte, wie sie sich schützen können. An wen sollte ich mich wenden, um einen Rechtsbeistand zu bekommen? An Len? Selbst wenn ich einen Anwalt zugeteilt bekäme und es eine Verhandlung gäbe, würde das Wochen, vielleicht Monate dauern. Eine Woche oder zwei … Jetzt muss etwas passieren.
Es klingelt.
Die Männer kommen aus ihren Zimmern und versammeln sich in einem großen Raum am anderen Ende des Flures. Wenn ich sie nur ansehe - die Ärzte mögen das Recht haben, mich hier zu behalten, aber ich bin nicht einer von denen, ich gehöre nicht in diese begrenzte Welt. Es ist ganz einfach: wenn mein Hiersein legal ist, dann auch mein Widerspruch. Ich hatte keine Ahnung, wie kompliziert der Weg werden könnte. Aber gut. Das Wichtigste ist, ruhig zu bleiben; nur nicht ausrasten. Keine Fenster einschlagen und nicht versuchen wegzulaufen. Das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Nein, ich werde mich auf meine Weise behaupten, einfach und würdevoll.
Eine Frau steht vor meiner Tür. "Ich bin Miss Lorraine", sagt sie freundlich. "Entschuldigen Sie die späte Begrüßung, aber ich möchte Sie auf unserer Station willkommen heißen. Es ist Zeit für den Nachmittagstee. Heute gibt es Karottenkuchen."
"Ich werde hier nichts essen", sage ich.



