




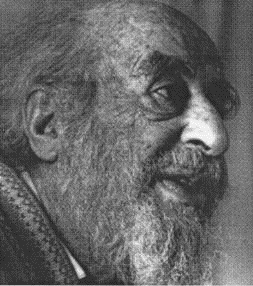
Lebensdaten: Friedrich (amerikanisiert Frederick, abgekürzt Fritz) S(alomon) Perls. Geboren 1893 in Berlin, gestorben 1970 in Chicago.
Fritz ist das dritte Kind (und der einzige Junge) einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Der Vater engagiert sich bei den Freimaurern. Fritz’ Verhältnis zu ihm, der seine Frau oft betrügt, ist gespannt.
Als Jugendlicher verdient er sich Geld durch Aushilfsarbeiten am »Königlichen Theater«, wo Max Reinhardt Regisseur ist. Fritz verehrt ihn und kommt in Kontakt mit linken Künstlerkreisen.
Er beginnt ein Medizinstudium. Im Ersten Weltkrieg wird er Rot-Kreuz-Helfer. Sein bester Freund fällt im Krieg. Die Konfrontation mit dem unerträglichen Leid machen Fritz zu schaffen. Nach dem Krieg promoviert er zum Dr. med. und wird Neuropsychiater.
In der esten Hälfte der 1920er Jahre lernt er Salomo Friedlaender kennen, den kantianischen Philosophen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Polaritäten zu überwinden und den »Punkt der schöpferischen Indifferenz« zu finden. Fritz fühlt sich zeitlebens den Ideen von Friedlaender verbunden.
Fritz liest auch Bücher von Sigmund Freud. 1925 beginnt er eine Psychoanalyse bei Karen Horney (1885-1952), die er auch später noch schätzt – (ganz anders als Paul Goodman, der in »Gestalttherapie« [1951] einige gehässige Bemerkungen gegen die »Washingtoner Schule der Psychoanalyse« unterbringt, der Karen Honery angehörte). Obwohl im Umkreis von Karen Horney auch Kritik an Sigmund Freud geübt wird, hält Fritz zunächst weitgehend loyal an Freud fest.
1926 erhält Fritz eine Assistentenstelle bei dem Neurologen Kurt Goldstein (1878-1965), der unter anderem Studien an Hirnverletzten durchführt. (Kurt Goldstein floh 1933 über Holland nach Amerika, wo er Englischunterricht bei Paul Goodman nahm und in den 1960er Jahren zum Mitbegründer der humanistischen Psychologie wurde.)
Bei Goldstein lernte Fritz die Gestaltpsychologie kennen. Darüber hinaus ging Goldstein von einer – wie er es nannte – »organismischen Selbstregulierung« aus, die einer jedem Organismus innewohnenden »Tendenz zum Ausgleich« in einem »mittleren Spannungszustand« entspringt.
In Frankfurt trifft Fritz auch seine spätere Frau, Laura Posner. Gemeinsam besuchen sie Veranstaltungen von Kurt Goldstein, Adhemar Gelb, Martin Buber, Max Scheler und Paul Tillich. Fritz begibt sich in Analyse bei Clara Happel. Politisch engagieren sich Fritz und Laura unabhängig, nicht parteipolitisch gebunden, im Kampf gegen den aufkommenden Nationalsozialismus.
Nach einem kurzen Zwischenspiel in Wien (wo sich aber kein Kontakt zu Freud ergibt), kehrt Fritz nach Berlin zurück. Er beginnt eine Psychoanalyse bei Eugen Harnick, die er abbricht, weil er Harnick als kontaktscheuen Zwangsneurotiker erlebt.
1930 heiraten Fritz und Laura. 1931 wird die Tochter Renate, 1935 der Sohn Steve geboren.
Fritz setzt seine analytischen Erfahrungen nun bei Wilhelm Reich fort. Hier erlebt er ein grandioses Kontrastprogramm. Der Analytiker ist nicht passiv, sondern äußerst aktiv. Es geht nicht nur um Erinnerung und Geist, sondern auch um Aktivität und Körper.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten fliehen Fritz und Laura Perls als Juden und Antifaschisten zunächst nach Amsterdam, wo sie aber keine Arbeitserlaubnis erhalten. Sie gehen dann nach Fürsprache von Ernest Jones (einem Mitarbeiter von Freud) nach Südafrika. Sie wurden zunächst sogar damit betraut, dort ein psychoanalytisches Institut aufzubauen.
In Südafrika leistete Fritz seinen Militärdienst als Arzt und arbeitet dann als Psychoanalytiker. Zusammen mit Laura schreibt er an einer Erweiterung der Freudschen Widerstandstheorie, die er die »oralen Widerstände« (siehe unter »Beißhemmung«) nennt: Es geht um den Widerstand, durch Zubeißen sich zu nähren – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. 1936 fliegt Fritz zu einem psychoanalytischen Kongress in Marienbad bei Prag, um seine Ideen zu präsentieren. Die Kollegen sind zurückhaltend und Sigmund Freud reagiert abweisend, was Fritz schwer enttäuscht.
Seine tiefe Betroffenheit verarbeitet Fritz, indem er sein Unbehagen an der Psychoanalyse in eine systematische Form zu bringen versucht. Dazu integriert er die Ideen von Kurt Goldstein und Salomo Friedlaender ebenso wie diejenigen eines neu entdeckten Autors, nämlich Jan Christiaan Smuts, der den Begriff des »Holismus« prägte und den Feldbegriff vorbereiten half. Smuts war übrigens kein professioneller Philosoph, sondern südafrikanischer Militär und Politiker.
In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre gerät die südafrikanische Politik immer tiefer in den Bann rassistischer Bestrebungen und Fritz und Laura Perls beschließen, in die Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Sie werden dabei unter anderem durch Karen Horney, die aus Deutschland direkt nach Amerika emigriert ist, unterstützt.
Noch in Südafrika hatten Fritz und Laura Texte von Paul Goodman gelesen, ein an Freud und besonders an Wilhelm Reich interessierter Schriftsteller und anarchistischer Aktivist. Sie nahmen Kontakt zu ihm auf, besonders weil Fritz auf der Suche nach jemandem war, der seine Ideen in systematischer Form in ein gutes Englisch bringen konnte.
Fritz und Laura vesammeln eine Gruppe von gestalttheoretisch orientierten Personen um sich, mit denen ein regelmäßiger Diskussionskreis entsteht: Paul Goodman, Isadore From, Paul und Lotti Weisz, Elliot Shapiro, Sylvester Eastman und Ralph Hefferline.
In diesen Diskussionen ergibt sich eine so große Entfernung von der Psychoanalyse, dass eine neue Form der Psychotherapie aus der Taufe gehoben wird: die Gestalttherapie. 1951 erscheint »Gestalt Therapy« mit einem praktischen, von Ralf Hefferline verfassten Teil und einem theoretischen Teil, der im Wesentlichen von Paul Goodman geschrieben wurde. Fritz erscheint jedoch an erster Stelle der Autoren. Laura möchte nach eigenem Bekunden nicht als Autorin genannt werden, obgleich sie einen wichtigen Anteil an der Theorieentwicklung hat.
1952 wird ein Gestalt-Institut in New York, 1953/54 in Cleveland gegründet. Fritz allerdings geht – nach einer kurzen Zeit in Miami (Florida) – an die Westküste nach Kalifornien. Der Grund für Fritz’ Weggang ist vor allem in Querelen in der Gestalt-Gruppe zu suchen. Fritz hat inhaltliche und persönliche Auseinandersetzungen besonders mit Paul Goodman. Laura, bei der Paul Goodman in Therapie ist, hält in diesen Auseinandersetzungen frustrierenderweise mehr zu ihm als zu ihrem Mann.
In der beginnenden Subkultur findet Fritz den idealen Nährboden für seine spontane Arbeitsweise. Er entwickelt mit großer Kreativität gestalttherapeutische Techniken, die schnell Anhänger finden. Der Begriff Selbstregulierung und der Nachdruck auf »seine Sache selbst in die Hand nehmen« passen genau in die Protestbewegung.
Ab 1963 arbeitet Fritz in Esalen (Kalifornien), wo er viele seiner berühmt-berüchtigten Demonstrations-Workshops abhält.
1969 zieht er sich mit einer Hand voll Anhängern nach Vancouver Island zurück, wo er einen »Gestalt-Kibbuz« gründet. Er stirbt 1970 auf einer Vortragsreise in Chicago.
Hauptwerke: Das Ich, der Hunger und die Aggression, 1944; Gestalttherapie (mit Ralph Hefferline und Paul Goodman, deutsch in zwei Bänden: »Grundlagen« und »Praxis«), 1951; Gestalttherapie in Aktion (Workshoptranskripte), 1969; In and Out the Garbarge Pail (Autobiografie), 1969; Grundlagen der Gestalttherapie (posthum 1976); Gestalt, Wachstum, Integration (Aufsatzsammlung, posthum, 1980); Was ist Gestalttherapie? (Workshoptranskripte, posthum 2004).
Würdigung: Auf die in den End-1960ern gestellte – scheinbar – unschuldige Frage der Journalistin Adelaide Bry hin, was Gestalttherapie sei, legte er dies nicht in gelehrten Sätzen dar, sondern verwickelte die Fragestellerin anstatt dessen in eine therapeutische Situation bezüglich ihrer Flugangst.
Die Frage der Journalistin war allerdings nur scheinbar unschuldig. Denn sie beinhaltet die Gefahr, nur zu glauben, was man erklärt bekommt, anstatt sich vielmehr darauf zu konzentrieren, was man wirklich wahrnimmt, erlebt oder erfährt. Auf diesem Hintergrund sagt Fritz Perls: Fragt mich bloß nicht, was Gestalttherapie ist, sondern schaut mir auf die Finger oder auf den Mund, und ihr werdet es sehen, hören, erleben. Damit setzt er übrigens stillschweigend auch voraus, dass es möglich ist, seine Arbeit mit- und nachzuvollziehen, also zu beschreiben, und in der Beschreibung die Struktur zu erkennen sowie den Zusammenhang zu begreifen.
Allerdings empfand Fritz Perls es nicht als seine Aufgabe, diese Arbeit des Erkennens und Begreifens zu leisten. Er war der Praktiker, und schon der erste unter den Philosophen, der Grieche Sokrates, hatte erkannt, dass es zu nichts führt, den Handwerker danach zu befragen, was er da eigentlich treibe. Der Handwerker liefert nicht die Theorie, sondern das Beispiel. Theorie wird dadurch nicht überflüssig, obgleich Fritz dies oberflächlich besehen behauptet. Erklärungen wie »Das ist so, weil …«, die typische Form von Theorie, bezeichnet er als »Geschwafel« der Kategorie »Bullshit«. Weiter sagt er: »Geschwafel hat natürlich gar keine Bedeutung. Worte lügen und überzeugen, die Stimme ist allerdings echt« (Workshop 1969, in: Was ist Gestalttherapie?, S. 83).
Diese Worte haben mehr Bedeutung, als ein flüchtiges Lesen deutlich macht. Um die zitierten Worte zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass Fritz im Deutschland der 1920er Jahre stark von der damals hochaktuellen philosophischen Strömung der »Phänomenologie« beeinflusst wurde.
Die Phänomenologie nimmt den Begriff »Wahrnehmung« ernst: Wahr ist, was wir für wahr »nehmen«. Etwas flapsig, wie es seiner Art entsprach, drückt Fritz dies aus, indem er sagt, Worte seien Geschwafel ohne (objektive) Bedeutung.
Fritz Perls hat aus dem erkenntnistheoretischen Programm der Phänomenologie ein psychotherapeutisches Programm gemacht: Berichtet ein Klient beispielsweise über seine Kindheit, ist es weniger hilfreich, diesen Bericht wie eine Repräsentation des objektiven Hergangs zu behandeln. Der Therapeut kann nicht wissen, was »wirklich« stattgefunden hat, und dies ist im Zweifel auch nicht erheblich. Erheblich ist dagegen, wie der Klient seine Kindheit in dem Moment, in welchem er sie dem Therapeuten berichtet, wahrnimmt. Der Therapeut kommt in Schwierigkeiten, sollte er versuchen herauszufinden, ob etwa ein bestimmtes traumatisierendes Erlebnis wirklich stattgefunden hat, denn dann müsste er »Detektiv spielen« und außerdem die Worte des Klienten anzweifeln.
Es ist allerdings auch kein sinnvoller Ausweg, dem Klienten einfach »alles zu glauben«, was er erzählt. Der Weg, den Fritz Perls vorgeschlagen hat, besteht darin, sich mit dem Wie des Berichtes zu beschäftigen, nicht so sehr mit dem Was, z.B.: Der Klient sagt, er sei traurig über seine Kindheit, aber seine Stimme ist anklagend.
Das meinte Fritz Perls mit »die Stimme ist echt«.
Doch auch hier müssen wir genau lesen. Es heißt nicht, dass die Stimme wahr sei oder die Wahrheit repräsentiere. Denn auch der Therapeut unterliegt dem phänomenologischen Programm. Er darf nicht behaupten, die Stimme seines Klienten sei objektiv gesehen »anklagend« und daraus Schlüsse ziehen: »Klient spricht mit anklagender Stimme, daraus folgt dies oder das«. Vielmehr kann der Therapeut nur für sich beanspruchen, dass er die Stimme des Klienten als anklagend wahrnimmt. Diese Wahrnehmung kann er dem Klienten zum Beispiel zur Verfügung stellen. Daraus kann nach gestaltischer Auffassung ein therapeutischer Prozess erwachsen (siehe mehr im Stichwort »Intervention«).
Damit hat Fritz Perls die Beziehung zwischen Klient und Therapeut neu definiert. Der Klient teilt nicht dem Therapeuten etwas mit, das der Therapeut mit Hilfe seines Expertenwissens objektiv interpretiert, um die richtige Behandlung einzuleiten. In einem solchen Setting ist der Therapeut gar nicht als Person anwesend. Die gestalttherapeutische Haltung besteht dagegen darin, dass der Therapeut sich ebenso wie der Klient als Person einbringt. Der Prozess der Therapie kommt als Austausch von Wahrnehmungen zustande: Dem Klienten wird, wie gesagt, die Wahrnehmung des Therapeuten zur Verfügung gestellt.
Diese gestalttherapeutische Haltung entspringt nicht einer zufälligen oder auch nur intuitiven Eingebung, die Fritz Perls hatte, sondern folgt dem phänomenologischen Programm. Insofern bildet Theorie einen notwendigen Hintergrund nicht nur für das Verständnis des Konzeptes der Gestalttherapie, sondern auch für das therapeutische Vorgehen insgesamt.
Dass wir zu Beginn an den Begriff »Stimme« angeknüpft haben, ist keine Willkür. Denn den Transkripten, aus denen die Hinterlassenschaft von Fritz Perls zum großen Teil besteht, fehlt naturgemäß die Dimension der Stimme. In Therapeutenkreisen, auch in denen von Gestalttherapeuten, wird bisweilen auf die »scharfe« oder »harte« Form therapeutischer Interventionen Bezug genommen, die Fritz Perls gepflegt haben soll. Manche gehen so weit, ihm eine »oft unmenschliche Art, mit seinen Klienten zu arbeiten«, vorzuwerfen.
Ganz anders stellt sich die Sache dar, wenn man die Tonband- oder Videoaufzeichnungen selbst in Betracht zieht, aus denen die Transkripte entstanden sind. Das haben wir getan. Zu Beginn der Arbeit hatten wir uns schon »sicherheitshalber« zusammengezogen, fast als müssten wir uns vor dem, was wir nun hören würden, selbst schützen. Es dauerte eine Weile, bis wir uns trauten, unserer Wahrnehmung zu trauen anstatt der negativen Vormeinung zu folgen. Denn erstaunt stellten wir fest, wie warm und freundlich Fritz’ Stimme war. Langsam fassten wir Zutrauen zu Fritz Perls. Dann war es so, als würde sich der Brustraum öffnen. Weiten. Wir bekamen mehr Luft zum Atmen, mehr Raum zum Spüren, mehr Raum für Empfindungen. Wir hörten seine Stimme und dachten: Wir brauchen keine Angst mehr vor ihm zu haben.
Fritz Perls schafft in seiner praktischen therapeutischen Arbeit Raum für den Klienten, damit dieser sich selbst entdecken kann. Er hält diesen Raum offen und sagt nicht, was »ist«, »wie« das zu verstehen sei und wo’s lang geht, sondern der Klient findet dies – mit Fritz’ Unterstützung – selbst heraus.
Der Klient geht dabei seinen eigenen Weg. Fritz sagt nicht, was am Ende des Weges dabei herauskommen soll. Ein großer Teil seiner Arbeit besteht darin, den Raum offenzuhalten, damit der Klient sich selbst erforschen kann. Denn wichtig ist, dass er sich nicht vorschnell ein Ziel für seine Arbeit steckt und dann mit dem Erforschen seiner selbst aufhört. Gestalt arbeitet nicht durch das Anstreben eines Ziels. Gestalt arbeitet durchs Finden und Kennenlernen des Weges.
Änderung geschieht nach gestalttherapeutischer Erkenntnis auf paradoxe Weise. Sie wird nicht angestrebt, indem man sich vornimmt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie geschieht vielmehr. Und sie geschieht nur dann, wenn man auch all diese abgelehnten Teile von sich annimmt, die man lieber verdrängen, oder anderen »andichten«, anderen anhängen möchte, aber auf jeden Fall wegbekommen möchte. Aber auch die Integration der verschiedenen Teile des Selbst wird nicht »gemacht«. Sie »widerfährt« uns als Gnade. Häufig sind Therapeuten dabei nicht mehr als nur Zeugen der Veränderung.
Fritz Perls: »Veränderungen finden von allein statt. Wenn wir tiefer in das eindringen, was wir sind, wenn wir akzeptieren, was da ist, kommen die Veränderungen von allein. Das ist das Paradoxon der Veränderung« (Was ist Gestalttherapie?, S. 49).
Arnold Beisser (ein früher Schüler von Fritz Perls und später ein guter Freund von ihm) hat die »paradoxe Theorie der Veränderung« ausgearbeitet – auf dem Hintergrund seines eigenen Lebens. Arnold Beisser war auf dem besten Wege, Tennisprofi zu werden, als er an Kinderlähmung erkrankte und sich ab dann fast nicht mehr bewegen konnte. Voller seelischer Qualen hat er das Paradox der Veränderung am eigenen Leib erlebt: Ein neues Leben begann für ihn erst, als er nicht mehr gegen seine Krankheit kämpfte, sondern sie annahm, sie nicht mehr abstreifen oder loswerden wollte. Eine neue Tür öffnete sich für ihn.
In den Perls’schen Transkripten wimmelt es von Begriffen wie »chicken shit«, »bullshit« oder sogar »elephant shit«, wie »mind fucking« und hin und wieder »dirty work«. Die sind zwar plakativ, aber irgendwie doch auch störend – jedenfalls heute. Aber denken wir zurück an die Zeit Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre. Damals haben viele so gesprochen, die einen Aufbruch wollten.
Diese Sprache hatte eine erleichternde, befreiende Wirkung. »Scheiße« sagen – das war auch ein Stück Auflehnung gegen die vorherrschende Sprache dieser Zeit (der Eltern, der Lehrer, der Pfarrer oder der Politiker) – eine Sprache, die nicht kraftvoll, klar und deutlich benannte, was tatsächlich ist, sondern eher vorsichtig, zu vorsichtig umschrieb. So vorsichtig, dass es eine Verdrängung und Verheimlichung war. Das Ausbrechen aus dieser konventionellen Sprache nahm das Ausbrechen aus den anderen Konventionen, Normen und Zwängen vorweg.
Lange Haare. Jeans. Jannis Joplin. Rolling Stones. Und die Sprache: Mist. Scheiße. Bumsen. Vögeln. Ficken. Es ging in dieser Zeit um neue Erfahrungen – nicht um Hirnwichsen. In den USA war »Woodstock« das Symbol dafür, in der BRD z.B. die Folk-Festivals in der Ingelheimer Kaiserpfalz – jedes Jahr am langen Pfingstwochenende. Ein Raum frei von Kontrolle. Ohne Repression. Freundliche Menschen. Erwachsene und Kinder – letztere in winzigen Schlafsäcken unter freiem Himmel, auf dem Zeltplatz oder gemeinsam in der Turnhalle. Wunderbare Musik – auch aus dem verlorenen Atlantis. Bunte Farben. Ingelheimer Rotwein. Hin und wieder ein Joint, der seine Runde machte.
Wer diese Zeit der heute so genannten »68er Generation« nicht miterlebt hat und wem diese Erinnerungen nichts sagen, sei schlicht eingeladen, über die heute eher »prollig« denn rebellisch klingende Sprache von Fritz hinweg zu sehen und dahinter auf die reife therapeutische Leistung zu schauen.
Laura Perls: »Ich lernte Fritz im Winter 1926 durch einen seiner Kollegen an Goldsteins Neurologischer Klinik kennen. Sein Name war Dr. Quadfasel, er war damals das Wunderkind [im Original deutsch] des Instituts. Er war 23 Jahre alt und hatte bereits seinen akademischen Abschluss. Seit damals sind wir gute Freunde geblieben; er lebt seit vielen Jahren in Amerika. 1934 wurde er von den Nazis für einige Zeit inhaftiert. Er ging dann nach London und später nach Amerika.
Daniel Rosenblatt: Wie war Fritz damals, 1926?
Laura: Fritz war ein hoffnungsloser Zyniker. Während des Ersten Weltkriegs war er verwundet worden und hatte eine Lungenentzündung. Das trug wahrscheinlich dazu bei, dass er später in Afrika emphysemisch wurde und Schwierigkeiten mit dem Herzen bekam. Aber das kam natürlich vor allem vom Rauchen, womit er in den Schützengräben angefangen hatte, als es nicht genug zu essen gab.
Rosenblatt: Wie war dein erster Eindruck von ihm, erinnerst du dich?
Laura: Mein erster Eindruck war: ›Da ist er.‹
Rosenblatt: Du wusstest es sofort? Was war es?
Laura: Da war ein Typ, den ich mochte, intelligent, klar und originell in den kleinen Dingen. Zu dieser Zeit hatte seine Kreativität keinen bestimmten Fokus. Er war kreativ im Reden. Er machte damals eine Analyse, ebenso wie Dr. Quadfasel. Die beiden hatten einen bestimmten Jargon miteinander, in den ich nicht eingeweiht war und eine Erfahrung, die ich nicht teilen konnte. Also machte ich auch eine Analyse. Eigentlich machte ich das, um »in« zu sein. Gleichzeitig studierte ich aber auch Gestaltpsychologie, und ich war damit sehr viel vertrauter als Fritz. Noch vor ein paar Jahren sagte er: »Ich wünschte, ich hätte mehr von Gestalt verstanden als ich noch bei Goldstein war.« Manches entging ihm. […]
Rosenblatt: Wie entwickelte sich Fritz’ Zynismus während der nächsten 40 Jahre?
Laura: Nun, er wurde etwas milder, aber – nun ja – ich war mir seiner nie wirklich ganz sicher, das konnte man nicht. Und ich hatte nie erwartet, dass er mich heiraten würde, aber ich war sehr in ihn verliebt. Nein, das stimmt nicht ganz; als ich ihm zum ersten Mal begegnete und er die ersten Annäherungsversuche machte, mochte ich seinen Geruch nicht.
Rosenblatt: Wegen der Zigarren?
Laura: Ja, und außerdem hatte er einen bestimmten Körpergeruch, den ich dann später gern mochte. Ich denke, es war eine Abwehrhaltung meinerseits. Ich wollte mich nicht einlassen, aber ich ließ mich ein.
Rosenblatt: Wie war eure Beziehung?
Laura: Zu Anfang war sie sehr zaghaft. Er war sehr schnell verletzt; eigentlich war er in dieser Hinsicht ein bisschen paranoid. Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal auf der Straße traf, ich freute mich, ihn zu sehen. Das Wetter war furchtbar, es hatte geregnet und die Sonne kam gerade heraus. Ich nahm die Gummiüberzieher von meinen Schuhen, und dabei kam ein bisschen Dreck auf seine Kleidung. Anscheinend empfand er das so, als ob ich ihn mit Dreck besudelte, er drehte sich um und ging. Ein paar Tage lang wusste ich gar nicht, was los war; ich war ganz unglücklich. Als wir dann zum ersten Mal zusammen aßen – das war in der Universität –, aß er Frankfurter Würstchen. Er nahm sich Senf und bekleckerte mich am Ärmel, und dann meinte er, das sei eine Liebeserklärung. Das ist witzig, ich habe lange nicht mehr daran gedacht, und vor allem nicht in dieser Verbindung. Wenn er mich besudelt, ist es eine Liebeserklärung, wenn ich es tue …; und er tat es mehr oder weniger absichtlich. Er war sich dessen sofort bewusst. Ich nicht, weißt du, ich hatte nur meine Schuhe herumgeschlenkert.
Rosenblatt: Offensichtlich warst du aufgeregt.
Laura: Ja.« (Laura Perls in einem Interview aus dem Jahre 1972, in: Anke und Erhard Doubrawa [Hg.], Erzählte Geschichte der Gestalttherapie, S. 49 und 51f.)
Arnold Beisser: »Als wir uns sahen, waren seine ersten Worte: ›Was ist denn mit Ihnen passiert?‹ [Beisser war gelähmt und saß im Rollstuhl.] Er sagte das mit solch kindlicher Unschuld und Verwunderung, dass ich es ihm nicht übel nahm. Er schien ganz einfach an dem Offensichtlichen, das einen starken Gegensatz zu dem Üblichen darstellt, interessiert zu sein. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie auf einen Schwerbehinderten reagieren sollen. Sie platzen tölpelhaft mit irgendetwas Unpassendem heraus, machen ihr Unbehagen deutlich oder ignorieren das Ganze einfach. Dann muss ich sie beruhigen oder auch in diese steife Vermeidungshaltung fallen. Seine erfrischend freimütige Reaktion zeigte wirklich nur echtes Interesse. Das war erleichternd.
Fritz Perls war ein Einzelgänger, ein in Berlin ausgebildeter Psychoanalytiker, der gegen jene Lehrer rebellierte, deren Autorität er bewunderte. Er sah etwas heruntergekommen aus wie ein ältlicher Hippie in einem zerknitterten Anzug. Zusätzlich zu seiner freudianischen Richtung hatte er auch in Frankfurt am Main bei den Anfängen der Gestaltpsychologie mitgearbeitet. Daraus hat er seine eigene Richtung entwickelt. Er verband Wissens- und Erfahrungsfragmente, ohne sich an deren Quellen erinnern zu können.
Obwohl er es niemals erwähnte – und ich kannte ihn schon mehrere Monate, bevor ich es herausfand –, bezeichnete er sein Konzept als ›Gestalttherapie‹. Aber seine wirkliche Kraft bestand in seiner Fähigkeit, direkten Kontakt mit dem Wesentlichen der Menschen und ihrer Situation herstellen zu können.
Eines der Lieblingsspielchen, die die Krankenhausärzte mit ihren Lehrern trieben, um sie zu testen, ist es, ihnen die extremsten und widerspenstigsten Fälle zu präsentieren. In einer großen Psychiatrie gibt es einige unmöglich bizarre Patienten. Diese Patienten sind therapieresistent. Fritz, der jeden vorgeführt haben wollte, erreichte bei einigen dieser therapeutisch unzugänglichen Fälle erstaunliche Ergebnisse. Im Kontakt mit ihm kamen diese Patienten in ihre beste Verfassung, sodass sie während der Gespräche mit Fritz ganz anders waren, als wir sie vorher kannten. Zum ersten Mal erschien ihr ganzes merkwürdiges Verhalten und ihr furchterregendes Sprachmuster klar verständlich. Er hatte Kontakt zu ihrer Stärke gefunden.
Genau das passierte auch bei mir. Obwohl er das so nie gesagt hätte, machte er mir klar, dass ich der Architekt dessen bin, wie ich meine Welt sehe, und nicht das hilflose Opfer. Ich fühlte mich durch ihn gestärkt und verstanden. Er hörte mir genau zu. Indem er meine Worte geringfügig interpretierend widergab, spiegelte er mir, was ich wirklich gesagt hatte. Damit wurden meine Worte in den Vordergrund gestellt und ich konnte sogar sehen, dass es Alternativen gab, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte.
Er war ein freier Mensch, der mir die Grundlage seiner Freiheit erklärte – dass er im Hier-und-Jetzt lebe, im einzigen Augenblick, in welchem man weder in seinen eigenen Glaubenssätzen gefangen ist, noch in den Mustern der Vergangenheit. Er zeigte mir, dass die Wahlmöglichkeiten sich vermehrten, sobald ich mich im Hier-und-Jetzt befand. Ich lernte zu leben, indem ich die Energie aus dem Hier-und-Jetzt nutzte. Andererseits lernte ich auch, dass ich eine wesentliche Rolle dabei spielte, mir die Zukunft zu gestalten, die ich mir wünschte. Vom intellektuellen Standpunkt aus gesehen erscheint Ihnen dieses ziemlich klar zu sein, genauso wie mir. Es aber zu verinnerlichen und in der Lage zu sein, es anzuwenden, war für mich neu.
Unsere Beziehung unterschied sich von den unpersönlichen Beziehungen, die ich vorher in der Analyse kennen gelernt hatte. Bei Fritz war alles absolut persönlich, und es gab keine Möglichkeit, dem, was real war, auszuweichen. Ich konnte ihn in verschiedenen Situationen beobachten und er war immer ein und derselbe. Da er in unserem Haus lebte, sah ich ihn beim Abendessen, bei der Arbeit, beim Aufwachen und wenn er sich zurückzog. Er liebte alles im Leben in gleicher Weise – jeder Mensch war für ihn einzigartig und doch gleich. Er lebte, was er glaubte. Nach dem Abendessen saßen wir und unterhielten uns. Ich gab vor, lernen zu wollen, wie er arbeitete und dachte. Im Rückblick jedoch erkenne ich, dass ich über das Verbessern meiner Arbeit hinaus danach suchte, ob es in jenem, was er wusste und tat, für mich eine Hoffnung geben könnte. Er bot mir an, mich mit ihm zu unterhalten oder ihn als Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Ich wendete ein, dass die Struktur unserer Beziehung sich mit guter Therapie nicht vertragen würde, die sich nur mit einem objektiven Therapeuten entwickelt. Geduldig erwog er mit mir jeden meiner Einwände« (Arnold Beisser, Wozu brauche ich Flügel?, 1989, S. 131ff).
Erving Polster: »Fritz Perls bot einen Workshop in Gestalttherapie an, und er war eine Offenbarung. Er war ein weicher, riesiger Pilz mit einem großen, alles überragenden Kopf und geschmeidigen Lamellen, mit denen er den Raum um sich herum einnahm. Er war die atmende Freiheit, und der Klang seiner Stimme vermittelte das Gefühl, man höre das Leben selbst sprechen. Er verfügte über eine enorme Feinfühligkeit und hatte großes Vertrauen in die Kraft, die daraus entstand, dass er die Menschen, mit denen er arbeitete, Schritt für Schritt begleitete.
Auch wenn es hart auf hart kam, konnte man ihm vertrauen. Einmal hatte er mich während einer Sitzung ermutigt, meine Wut zum Ausdruck zu bringen. Ich schrie und schluchzte und kehrte schließlich in einem tiefen Gefühl des Alleinseins zu mir selbst zurück. Ich konzentrierte mich auf mein Inneres, auf das einzige Licht, das noch da war, und plötzlich spürte ich seine Hand. Ich öffnete meine Augen, und er war da, ganz zärtlich. In diesem Moment liebte ich ihn. Wir umarmten uns, er sagte ein paar sanfte Worte, an die ich mich nicht erinnere und ich fühlte mich innerlich erleichtert.
Er war ein rauher Kerl, war eben Fritz, wie viele damals meinten, und er ist weithin bekannt als jemand, der scharf und abweisend sein konnte, wenn er sich gerade so fühlte. Er ist weniger bekannt für seine außerordentliche Sanftheit, und genau diese Fähigkeit, zusammen mit seiner unvergleichlichen Fantasie und Feinfühligkeit, machte seine Arbeit so erfolgreich. Man wusste, dass er sowohl die Schattenseiten des Lebens als auch seine lichtesten Momente kannte.
Einmal fragte er mich in einem Workshop während der Pause, warum ich so still sei. Ich sagte ihm, ich sei ängstlich. Er meinte, er wisse, wie das sei; er selbst sei bis vor ein paar Jahren so schüchtern gewesen, dass er in der Öffentlichkeit kein Wort herausbrachte, wenn er nicht ablesen konnte. Ich war erstaunt und fühlte mich durch seine Offenheit bereichert. Später in der Gruppe nannte er mich den Störenfried, weil ich nichts sagen wollte, was den Prozess in irgendeiner Weise stören könnte. Er ermutigte mich, zu stören, wann immer es mir in den Sinn kam, und ich probierte es. Ich ließ meinen Assoziationen freien Lauf und kommentierte das ganze Geschehen, bis er schließlich mit mir böse wurde.
›Aber du hast ihm doch gesagt, dass er stören soll‹, meinte jemand aus der Gruppe.
Fritz antwortete, ›Ja, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass es mir gefallen würde.‹
Ich machte trotzdem weiter und erhielt eine meiner wichtigsten Lektionen. Was als Störung und Unterbrechung angefangen hatte, entwickelte sich zu einer echten Führungsqualität. Fritz war sehr feinfühlig, aber wenn er das Gefühl hatte, dass jemand ihn in die Enge treiben oder ihm etwas aufzwingen wollte, konnte er auch zu einem richtigen Dreckskerl werden. Seine eigene Weigerung, das Gift seiner Umgebung einzuatmen, war Ausdruck seiner grundlegenden Botschaft, nämlich dass jeder Mensch sein eigenes Leben kreiert.
Fritz öffnete vielen die Augen, zunächst in Cleveland und später im ganzen Land. Bei uns erlebte er den ersten Durchbruch seiner neuen Therapiemethode. Er war gegen jedes Intellektualisieren, und wie mir inzwischen klar geworden ist, schaffte er sehr schnell eine vertrauensvolle Atmosphäre. Er beschrieb, was guten Kontakt ausmacht und führte es vor, ohne dabei seicht zu werden oder besonders professionell wirken zu müssen. Er zeigte, wie guter Kontakt zusammen mit den Techniken der Gewahrseinssteigerung die Entwicklung grundlegender emotionaler Erfahrungen verstärken konnte. Die daraus entstehende Gefühlsintensität war für damalige Verhältnisse eine Seltenheit. In einer Gruppe von fünfzehn Leuten zu weinen galt als beachtlich, und vielen, die seine Methoden als gefährlich und verantwortungslos betrachteten, erschien ein solches Verhalten höchst fragwürdig.
Wir wurden damals in Cleveland heftig angegriffen, aber unsere Gemeinschaft hatte zuviel Neues und Aufregendes zu entdecken, als dass wir uns darüber Sorgen machten, wie angesehen wir bei denen waren, die Gerüchte über unsere bacchantischen Rituale verbreiteten. Ich wünschte, manche dieser Gerüchte wären tatsächlich wahr gewesen.
Das Neuartige lag für mich in der Möglichkeit, Therapie zu erfahren, anstatt nur zu versuchen, sie zu verstehen. Diese Orientierung erscheint uns heute als alter Hut, aber zu jener Zeit war sie der Anfang einer fundamentalen Veränderung meiner professionellen Grundlagen. Ich hörte auf, bloß professionell zu sein und erlaubte mir selbst, mich so weit wie nötig einzulassen, um eine Atmosphäre tiefen Vertrauens zu schaffen. Ich wandte mich nicht mehr bloß dem äußeren Leben meiner Klienten zu und erreichte so ein größeres Maß an persönlicher Anteilnahme. Ich kam hinter meinem Schreibtisch hervor und begann, mir selbst mehr Authentizität zuzugestehen. Wenn sich Intimität entwickelte, empfand ich sie nicht mehr nur als Übertragung durch den Patienten im professionellen Rahmen, sondern als gerechtfertigte Antwort auf die Kunst, die ich ausübte; als gemeinsame Begeisterung für die Kreation eines erfüllenden Dramas« (Erving Polster, Von Zigeunern geraubt: Persönliche Erfahrungen mit der Gestalttherapie, in: Gestaltkritik 1/1998).
Literatur: Patruska Clarkson / Jennifer Machewn, Frederick S. Perls und die Gestalttherapie (1993), Köln 1995; Milan Sreckovic, Geschichte und Entwicklung der Gestalttherapie, in: Fuhr u.a. (Hg,), Handbuch der Gestalttherapie, 2001.

Lebensdaten: Geboren 1905 als Lore Posner in Pforzheim, gestorben daselbst 1990. Sie stammt aus einer jüdischen Juweliersfamilie. Sie hat eine Schwester und einen Bruder. Als einziges Mädchen besucht sie ein Gymnasium und fängt nach dem Abitur zunächst ein juristisches Studium an, wechselt jedoch schnell zu Philosophie und Psychologie.
In Frankfurt besucht sie Seminare und Vorlesungen u.a. von Max Scheler, Paul Tillich, Kurt Goldstein, Adhemar Gelb (der ihr Doktorvater wird) und Martin Buber.
In einem Kolloquium, das Goldstein und Gelb gemeinsam halten, lernt sie 1926 Fritz Perls kennen. Sie folgt ihm auf seinen verschlungenen Lebenspfaden, hält sich jedoch stets im Hintergrund.
Allerdings ist ihr Einfluss auf die Theorieentwicklung zunächst von Fritz und später von der gesamten Gestalttherapie enorm.
Nach der Geburt ihrer Tochter Renate 1931 beschäftigte sich Laura mit dem Verhalten von Säuglingen beim Stillen. Psychoanalytiker sprachen hier von »oral-sadistischen Impulsen«. Laura (und Fritz) versuchten, dieses Verhalten nicht (ab)wertend zu betrachten, sondern als erste Versuche einer sich die Umwelt zum eigenen Überleben aneignenden, natürlichen Auseinandersetzung, die sie im positiven Sinne Aggression nannten.
Dann wendeten sie sich dem Übergang vom Saugen zum Kauen zu. Dieser Übergang kennzeichnet eine neue Stufe der »Aggression«, die notwendig ist. Wenn an dieser Stelle die Aggression gehemmt wird, legt das den Grundstein für spätere Probleme des Individuums, sich der Umwelt aggressiv zu nähern. Zunächst sprachen sie von »oralem Widerstand« (später ist, bildlicher, von »Beißhemmung« die Rede).
Mit diesen Überlegungen schuf Laura die Grundlage der späteren gestalttherapeutischen Theorie der Aggression. In einem Vortrag 1939 formulierte Laura die zentrale Gleichung der neuen Aggressionstheorie: »Die Verdrängung der individuellen Aggression [führt] unweigerlich zu einem Anstieg der universellen Aggression« (Vortrag über Friedenserziehung in Johannisburg 1939, zit. n.: Laura Perls, Leben an der Grenze, S. 14f). Sie half Fritz im südafrikanischen Exil, das Buch »Das Ich, der Hunger und die Aggression« (1944) zu schreiben. Sie bestand jedoch nicht darauf, als Mitautorin genannt zu werden.
Paul Goodman entwickelte in Anschluss an Freud und Reich ähnliche Überlegungen und benutzte dazu den Begriff »natürliche« oder »gesunde Gewalt«, deren Unterdrückung zum universellen Kriegs- und Zerstörungswunsch führe. Seine entsprechenden Aufsätze (und den Roman »The Grand Piano«) lasen Laura und Fritz Perls noch in Südafrika; so war es ganz folgerichtig, dass sie Paul Goodman aufsuchten, nachdem sie Ende der 1940er Jahre nach New York gingen. Paul Goodman wurde ihr Klient, Geliebter, Freund und Kollege.
Auch an dem Buch »Gestalt Therapy« von 1951 hat Laura einen großen, jedoch nicht ganz genau festzustellenden Anteil. Wieder verzichtet sie darauf, als Autorin in Erscheinung zu treten. Allerdings wählt man sie, um ihr Anerkennung und Respekt zu zollen, zur Präsidentin des »New York Institute for Gestalt Therapy«, das sie in antibürokratischer und antiautoritärer Weise führt.
Laura und Fritz entfremdeten sich zunehmend. Fritz ging nach Kalifornien und Laura blieb in New York bei den Freunden der ursprünglichen Gestaltgruppe.
Anlässlich von Fritz’ Tod sorgte Laura für einen Eklat, als sie Paul Goodman die Rede auf der Trauerfeier in New York halten ließ. Goodman hatte zwar mit Laura am Telefon geweint, als sie ihm von seinem Tod berichtete, wollte es sich jedoch nicht versagen, bei der Rede auch Kritik an dem verstorbenen Mitstreiter zu üben.
Noch mehr als zwanzig Jahre setzte Laura ihre im Gegensatz zu Fritz »stille« Gestaltarbeit fort. Sie betonte die Vorsicht und Zurückhaltung bei der Arbeit, wies darauf hin, dass der Klient Unterstützung (»support«) benötige und betonte die Wichtigkeit von Theorie, Philosophie und Kunst bei der Ausbildung von Gestalttherapeuten.
Laura Perls über die Ziele der Gestalttherapie: »E. Mark Stern: Laura, was sind aus deiner Sicht die Ziele der Gestalttherapie?
Laura Perls: Kontinuierliche Gestaltbildung. Damit meine ich, dass alles, was für den einzelnen, für Gruppen, Paare, Familien oder soziale Bewegungen wichtig und interessant ist, in den Vordergrund tritt, wo es klar und deutlich erfahren und bearbeitet werden kann. Sind diese Interessen dann befriedigt oder erfüllt, können sie wieder in den Hintergrund treten und den Vordergrund frei machen für die nächste Herausforderung – für die nächste Gestalt.
E. Mark Stern: Wenn wir das nun einem Studenten klarmachen wollten, wie würden wir das am besten ausdrücken?
Laura Perls: Zunächst einmal würde ich erklären, was der Begriff ›Gestalt‹ bedeutet. Gestalt ist eigentlich ein philosophisch-ästhetisches Konzept. In Deutschland gibt es Kunsthochschulen, die sich Hochschule für Gestaltung nennen, und da der Begriff Gestaltung keine einzelne, fixierte Gestalt beschreibt, sondern einen Prozess, wäre Gestaltungstherapie eigentlich treffender als Gestalttherapie. Denn fixierte Gestalten sind ja genau das, was wir in der Therapie oder der Theorie nicht anstreben.
E. Mark Stern: Es geht dir um ein konstantes, offenes Feld, das Hinweise auf ein fehlendes Element enthält, das zu einem Gefühl von Geschlossenheit führen könnte. Was die Gestalttherapie aber auch deutlich macht, ist, dass es so etwas wie absolute Vollständigkeit oder Geschlossenheit nicht unbedingt geben kann.
Laura Perls: Geschlossenheit gibt es immer nur vorübergehend. Wenn ich eine absolute Geschlossenheit anstrebe, dann ist diese Geschlossenheit in der Regel übereilt und äußerst eng.
E. Mark Stern: Aber die Aussicht auf Schließung erzeugt Hoffnung. Ich nehme an, dass es diese Art von Hoffnung ist, worauf es in der Therapie wirklich ankommt.
Laura Perls: Die Aussicht auf Offenheit erzeugt Hoffnung.
Richard Kitzler: Oder die Schließung erzeugt Offenheit. Ich verstehe Laura so, dass Kontakt zu einer Abstraktion führt – dass man sieht, was im Hinblick auf das eigene Wachstum zur Verfügung steht und sich dann dem nächst dringenden Bedürfnis zuwendet.
Laura Perls: Wir haben die Verpflichtung, dass die Gestalttherapie nicht selbst zu einer fixierten Gestalt wird.
Richard Kitzler: Das ist sie schon. Um Gestalttherapie zu erklären, müsste man über die Sprache hinausgehen und Aspekte wie Körpersprache oder Haltung mit einbeziehen. Aus der Art, wie jemand steht und sich Boden verschafft, lässt sich manches ersehen. Es geht darum, das, was Laura in Worte fasst, auch zu erfahren.
E. Mark Stern: Ob man sich mit der Körperhaltung oder den Vorstellungen eines Menschen befasst, man sollte sich bewusst sein, dass es darum geht, Fixierungen zu vermeiden. In deiner Sprache bedeutet ›sich Boden verschaffen‹, durch das, was man assimiliert hat, Unterstützung zu erfahren. Das erzeugt Offenheit.
Richard Kitzler: Andernfalls stecken wir auf ewig in dem, was wir Objektkonflikt nennen.
Laura Perls: Bedeutung entsteht aus der Beziehung zwischen Figur und Grund.
E. Mark Stern: Mit all dem neuerdings wieder auflebenden Interesse an der psychoanalytischen Objekt-Beziehungs-Theorie kann man im Rahmen dieser Theorie feststellen, dass sich das Selbst im Auftauchen und/oder Verschwinden von Objekten erst konstituiert, während es aus gestalttheoretischer Sicht ein Gegebenes ist, das sich in vielen Ganzheiten widerspiegelt.
Richard Kitzler: Die Objekt-Beziehungs-Theoretiker haben versucht, die Spaltung zwischen Geist und Körper zu überbrücken, ohne es zu schaffen. Und nun endet man mit allerlei Verdrehungen, einer Geheimsprache und abgehobenen Aussagen. Die Gestalttherapie schließt eine solche Spaltung von vornherein aus und befasst sich statt dessen mit der Interaktion und dem Kontakt an der Grenze zwischen Organismus und Umwelt.
E. Mark Stern: Mir ist aufgefallen, dass Ernest Becker in einer seiner späteren Veröffentlichungen auf deine Arbeit aufmerksam geworden ist: ›Wie Laura Perls so lebendig formuliert, schwankt der Mensch zwischen diesen beiden Polen. Der eine Pol gibt ihm das Gefühl von überwältigender Wichtigkeit und der andere das von Angst und Frustration.‹ Das Originalzitat stammt aus ›Gestalt Therapy Now‹ (1971).
Laura Perls: Um es noch deutlicher zu machen: Der Neurotiker ist jemand, der Angst hat, sich mit dem Prozess des Sterbens auseinanderzusetzen, und deshalb kann er nicht leben. Sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein, ist in der Tat ein Anreiz zu leben.
Mir wurde das mit ungefähr 24 Jahren bewusst, bei der Beerdigung eines Freundes, der mit 26 an einer Infektion gestorben war. Es gab damals keine Antibiotika. Das war ein sehr schockierendes Erlebnis für mich; als ich den Friedhof jedoch verließ, erschien mir die Welt plötzlich sehr hell und heiter, und ich fühlte mich voller Energie. Ich konnte mir das nicht erklären und erzählte es am nächsten Tag meinem Analytiker. Ich hatte das Gefühl, dass wenn wir uns der Tatsache, dass wir eines Tages sterben werden, nicht bewusst wären, sich unser Leben von dem eines Tieres kaum unterscheiden würde – dass die Lebenslust und der Drang zum Leben beim Menschen mit dem Bewusstsein des Sterbens einhergehen. Die Antwort meines Analytikers war: ›Jetzt ist deine Analyse beendet.‹
E. Mark Stern: Laura, wie geht es dir angesichts der Verbindung von Gestalttherapie und anderen therapeutischen Richtungen wie etwa der Transaktionsanalyse oder der Psychoanalyse?
Laura Perls: Im Rahmen von Gestalt ist jedes Verfahren anwendbar, so lange es existenziell und erfahrungsorientiert ist – und experimentell in dem Maße, wie Unterstützung für das Experiment mobilisiert werden kann.
E. Mark Stern: Aber die Transaktionsanalyse lässt sich kaum als existentieller Ansatz verstehen, sondern nähert sich dem Menschen auf äußerst mechanische Weise.
Laura Perls: Die Lebensskripte, von denen die Transaktionsanalyse spricht, sind nichts anderes als fixierte Gestalten, und wenn man ein neues Skript schreibt, ist das wiederum eine fixierte Gestalt.
Richard Kitzler: Du hast einmal gesagt, dass ein Anhänger einer bestimmten Denkschule, der seinen Ansatz mit seiner Erfahrung in Einklang gebracht hat, sich einer ganzen Reihe von technischen Herangehensweisen bedienen kann.
Laura Perls: Ich würde lieber von Stilen als von Techniken sprechen. Einen persönlichen Stil entwickelt man aus dem eigenen Hintergrund und der eigenen Erfahrung heraus.
E. Mark Stern: So dass der Stil sich wirklich auf den Einzelnen bezieht, während eine Technik sich auf ein Schema oder eine fixierte Gestalt bezieht.
Laura Perls: Und Stil ist umfassender.
E. Mark Stern: Mir scheint, dass wir gerade ein Verständnis dafür entwickeln, wie die Gestalttherapie mit dem Phänomen der Übertragung umzugehen beginnt.
Laura Perls: Was übertragen wird, ist nicht die Vater-Mutter-Kind-Beziehung, sondern bestimmte fixierte Verhaltensweisen, die zur Zeit ihrer Entstehung keinen Widerstand darstellten, sondern hilfreich waren. Es sind Entwicklungsaspekte, die sich verselbständigt und automatisiert haben. Das heißt, es handelt sich um eine fixierte Gestalt, deren man sich nicht bewusst ist. Was wir in der Gestalttherapie tun ist, diese fixierten Gestalten zu ent-automatisieren und dadurch dem Klienten bewusst zu machen, dass er hiermit über Energieressourcen verfügt, die eine neue Handlungsbasis darstellen können« (1982, in: Laura Perls, Meine Wildnis ist die Seele des Anderen, Wuppertal 2005, S. 174ff).
Erving Polster: »Bei Laura hatte ich meine allererste Einzelsitzung. Sie kam zu einem Workshop, in dem wir auch Einzelsitzungen hatten, und ich hatte eine bei ihr. Innerhalb sehr kurzer Zeit machte sie ein paar Sachen mit mir, die mir die Augen öffneten. Inzwischen weiß ich, dass es sehr einfache Dinge waren, aber mit weitreichenden Folgen.
Es ging um meinen Vater. Ich hatte etwas über meinen Vater gesagt, und dann machte ich einen Moment lang die Erfahrung, wie es war, mein Vater zu sein. Ich konnte fühlen, wie umfassend und stark sie in diesem Moment mit mir verbunden war. Sowohl bei ihr als auch bei den anderen spürte ich einen großen Reichtum an Erfahrung. Ich dachte, dass ich von ihr eine Menge über Sprache und Bewegung lernen könnte.
Als ich später einen ihrer Workshops besuchte, bemerkte ich, dass sie sich sehr fein und sehr genau auf bestimmte Dinge einstellte, die die Teilnehmer taten. Sie wusste, wie sie so etwas entwickeln konnte. Was mir bei ihr auffiel, und was ich bei Fritz oder Paul Weisz nicht gesehen hatte, vielleicht nicht einmal bei Isadore, war – wie soll ich es nennen? – eine bestimmte Art des warmen Einfühlens, ein Sich-Einwärmen in den anderen. Sie kam einem körperlich näher. Sie lächelte. Nebenbei sagte sie ermutigende Dinge. Und sie scheute sich nicht, durch ihre Gesten und Bewegungen ganz klar und deutlich Unterstützung zu geben« (in: Anke und Erhard Doubrawa [Hg.], Erzählte Geschichte der Gestalttherapie, S. 200f).
Daniel Rosenblatt: »[Therapie bei Laura Perls.] Ich erinnere mich, dass wir zusammensaßen und rauchten und dass sie strickte! Das war aber nicht feindselig, sie war immer da. Es ist ein Kontrast aus der Sicht der Gestalttherapie, weil kein Gestalttherapeut je stricken würde, aber das kriegte ich gar nicht mit, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie nicht aufmerksam war. Ich glaube, dass zu jener Zeit viele weibliche Analytiker strickten, einfach weil sie so viel Zeit mit rumsitzen verbrachten. Sie machte bzw. wir machten damals keine freien Assoziationen.
Die andere Sache, die mir natürlich sofort einfällt, ist, dass ich 23 war und Laura ungefähr 43, weil sie 20 Jahre älter ist als ich, und zu jener Zeit war sie eben für mich eine Frau mittleren Alters. Da ich nun fast 20 Jahre älter bin als sie damals, ist es schwer für mich, mir das vorzustellen. Ich meine, sie war damals wirklich eine junge Frau, wenn man so will, ungefähr in eurem Alter, und der Abstand zwischen 23 und 43 war sehr groß, aber ich habe aufgeholt. Sie erschien mir damals viel älter und mütterlicher; aber wahrscheinlich teilweise nur aus meiner damaligen Sicht.
Anna [Sreckovic]: Ich möchte etwas mehr darüber hören, wie es für dich nach deinen Erfahrungen mit der Psychoanalyse war, mit Laura zu arbeiten. Was war das Besondere an ihrer Arbeit in jenen Tagen?
Dan [Rosenblatt]: Nun, sie war sehr persönlich und direkt, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich wie ein Patient verhalten sollte. Sie arbeitete nicht nach einem medizinischen Modell, und ich fühlte mich immer als Person angesprochen und nie als jemand, der bewertet wurde, fühlte mich nie als Kranker. Ich konnte mit ihr über meine Erfahrung sprechen und hatte nie das Gefühl, dass sie mir nicht direkt antwortete. Ich hatte nie den Eindruck, mich zu unterwerfen, gezwungen oder von oben herab behandelt zu werden. In der Psychoanalyse muss man, selbst wenn der Analytiker ein warmherziger Mensch ist, die Position des Patienten hinnehmen. Die Couch benutzte sie (im Gegensatz zu Fritz) nicht mehr. In der Arbeit mit ihr erfuhr ich sehr deutlich, was es heißt, authentisch zu sein« (in: A. u. E. Doubrawa [Hg.], Erzählte Geschichte der Gestalttherapie, S. 267f).
Kristine Schneider: »Therapie versteht sie [Laura Perls] als den Weg vom Fremdsupport, der Stütze von außen, zum Selbstsupport, der Unabhängigkeit von fremder Hilfe. Die Aufgabe der Therapie sieht sie in der Herstellung einer existenziellen mitmenschlichen Beziehung zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten, in der Nacherziehung und Umerziehung stattfindet.
Hauptstütze dieser therapeutisch ergänzenden ›Pädagogik‹ ist der direkte und vorbehaltlose Kontakt zum Therapeuten, weil durch ihn der Kontakt des Patienten zu sich selbst erleichtert wird. Selbstsupport ist wichtig für die fortlaufende Gestaltbildung. Folgerichtig gibt Laura der therapeutischen Situation mehr Natürlichkeit: ›Ich habe fünfzehn Jahre lang Analysen durchgeführt und weiß, was es heißt, ohne die Stütze des Kontakts zu sein. Der Patient bleibt ohne Selbstsupport, erinnert sich mehr und mehr, bekommt Interpretationen, die er entweder glaubt oder nicht. Ich saß hinter dem Patienten, er blickte zur Wand. Wie sollte da ein Dialog aufkommen?‹
Also setzt sie sich dem Patienten gegenüber und wird für ihn Person. Das Kontakt/Support-Konzept rückt ins Zentrum. Zu seiner Orientierung darf der Patient sich auf den Raum, die Zeit und seine Mitmenschen beziehen, das allein gibt schon Stütze. Ihm wird wirklich zugehört, er wird wörtlich genommen, und anstatt analysiert zu werden, erhält er Hilfen, die richtigen Ausdrücke, die passenden Bewegungen, eine gelockerte Körperhaltung zu finden, mit der er sich stark genug vorkommt, um die Grenzerfahrung einzugehen.
Mit ernsten Vorbehalten notiert Laura die Fixierung mancher Therapeuten in konfrontativem Vorgehen. Für sie hat übermäßige Konfrontation antitherapeutischen Stellenwert: ›Das sind Leute, die den Zusammenbruch suchen, nicht den kalkulierbaren Durchbruch. Einfach zu durchbrechen, womit jemand sich schützt, ist kurzsichtig.‹ Folgerichtig schont sie den Rest an Selbstsupport, den der Patient mitbringt, einschließlich seiner Widerstände. Ihre Begründung: ›Eine neue Stütze findet man nicht sofort‹, und: ›Das Fehlen des wesentlichen Support führt immer in die Angst.‹
Ihre Art, Gestalttherapie auszuüben, beruht auf einer Reihe klarer und einfacher Grundsätze – was nicht heißt, sie wären einfach zu finden gewesen. Wie alles Einfache – und Wahre – forderten sie viele Jahre disziplinierter Reflektion: nicht überfordern, an der subjektiven Wahrnehmung des Patienten bleiben, ihn da abholen, wo er sich innerlich befindet, ihn die eigenen Grenzen erleben und die Dynamik seiner Grenzziehung durchsichtig werden lassen. Menschen ohne klare Grenzen sind für Introjektion und Projektion offen und erkennen nicht mehr, wer sie selbst sind und wer der andere ist, sie haben das Gespür für das verloren, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist.
Wer mit Laura gearbeitet hat, weiß um ihre Fähigkeit, sich Kummer wirklich angehen zu lassen, ohne ihn zu ihrem eigenen Kummer zu machen, sich mitzufreuen und mit aufzuregen; alle konnten sie als Freundin kennen lernen, die manchmal amüsiert, manchmal neugierig und gelegentlich betroffen war, die jedoch genügend Distanz zum Geschehen hatte, so dass ihre Einfälle zur Erprobung des Neuen niemals versiegten. Die Einfachheit ihrer professionellen Grundsätze hat gelegentlich dazu verführt, sie zur Weltanschauung und zu Patentrezepten zu versimpeln – ein Missverständnis, das Laura stets dazu herausforderte, die Betreffenden mit ihrer fehlerhaften intellektuellen Verdauung zu konfrontieren.
Domäne ihrer therapeutischen Arbeit war die Gründlichkeit im Detail. Fern von allem Kulthaften und Quasireligiösen, das – zu Lauras Leidwesen – oft in Verbindung mit Gestalttherapie auftritt und sogar damit verwechselt wurde, betrieb sie eine Therapie von Eleganz, gepaart mit Nüchternheit; eine Kleinarbeit, die als gelungene Synthese von Phänomenologie, genauem Hinsehen, Psychodynamik, dem Erfahren der Tiefe und dem Experiment, das in der geplanten Verhaltensvariation besteht, anzusehen ist. Schrittweise spürte sie Blockierungen auf und brachte sie in den Vordergrund der Awareness durch Übertreibung einer der darin verwickelten Polaritäten, um von da aus Experimente in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Das Experiment befreit die Dynamik, und umgekehrt trägt die Dynamik das Experimentieren, bis das volle Kontakterlebnis sich einstellt.
Für die Ausbildung dreier Generationen von Gestalttherapeuten zeichnet sie verantwortlich. Viele ihrer Schüler haben sich über die USA hinaus einen Namen gemacht: Paul Weisz, Isadore From, Erv und Miriam Polster, Jim Simkin, Edward Rosenfeld, Joseph Zinker und andere. In der Festschrift für Laura Perls, die das ›Gestalt Journal‹ herausgegeben hat, äußern sich viele, die bei ihr gelernt haben, mit einer Herzlichkeit, die Laura verdient hat. Bei ihr fanden sie eine durchgängige Akzeptanz, die besonders dann spürbar wurde, wenn sie sich selbst nicht im besten Zustand befanden. »Auf einen Therapeuten muss man sich verlassen können,« sagte Laura und meinte damit professionelle Verlässlichkeit durch persönliche Stärke und durch Behutsamkeit« (Kristine Schneider, 1993, in: Laura Perls, Meine Wildnis ist die Seele des Anderen, Wuppertal 2005, S. 209ff).
Literatur: Laura Perls, Leben an der Grenze, Köln 1989; Laura Perls, Meine Wildnis ist die Seele des Anderen: Im Gespräch mit Daniel Rosenblatt u.a., Wuppertal 2005.

Lebensdaten: Paul Goodman, jüdischer Abstammung, wurde 1911 in Greenwich Village, New York, geboren. Von den Eltern, von Beruf Schausteller, vernachlässigt, wuchs er unter der Sorge seiner Schwester Alice und verschiedener Tanten auf. Sein Bruder Percival (Jahrgang 1904) hatte sich früh selbstständig gemacht und in Paris an der »Ecole des Beaux Arts« studiert. Er wurde Architekt.
Paul musste sich sein Studium der Literatur und Philosophie, das er 1931 in Chicago begann, durch Jobben verdienen. Nebenbei eignete er sich autodidaktisch Deutsch und Griechisch an; Latein und Französisch hatte er bereits auf der Schule gelernt. In diese Zeit fallen seine ersten literarischen Arbeiten, die er teils in kleinen Avantgarde-Magazinen veröffentlichen konnte.
Nachdem Goodman mit der – unveröffentlichten – Arbeit »The Formal Analysis of Poems« [Die formale Analyse von Gedichten] und mündlichen Prüfungen u.a. über Erkenntnistheorie und Kants Ästhetik zum Ph.D. promoviert hatte und an der »University of Chicago« einen Lehrerposten antrat, schien seine Karriere festzustehen. Sein Thema war Shakespeare. Die Methode der Deutung war die sich auf Aristoteles stützende immanente (»formale«) Analyse der »Chicago School of Critics«, aus der Goodman entstammte.
Allerdings verlor Goodman seine Stelle 1940, weil er ein offenes Ausleben seiner Homosexualität sowohl als sein Recht als auch als pädagogisch sinnvoll proklamierte. Aus dem gleichen Grund musste er seine danach angetretene Tätigkeit an der »Manumit School« und am »Black Mountain College« aufgeben, beides renommierte »alternative« Institutionen. Zur selben Zeit wurde seine Kurzgeschichte »A Cerimonial« [Eine Zeremonie] (1940) gedruckt, die in literarischen Kreisen für Aufsehen sorgte. Susan Sonntag zählt Goodmans frühe Kurzgeschichten zur wichtigsten Prosa der nordamerikanischen Literatur.
Da ihm der Zugang zu den akademischen Institutionen versperrt war, lebte Goodman weiterhin von Gelegenheitsjobs und sein Einkommen lag nur knapp über dem Existenzminimum. Seine Bücher wurden von kleinen Verlagen, die keine Honorare zahlen konnten, in geringen Auflagen gedruckt. Obwohl er unter den Literaten ein Geheimtipp war, verkauften sich seine Bücher nur schlecht. 1941 erschien »Stop Light: 5 Dance Poems« [Rotlicht: 5 Tanzgedichte], fünf Bühnenstücke, für die er die Form des japanischen »Noh« benutzte. Das war während des Krieges – kurz nach Pearl Harbor – nicht sehr populär. Ein Jahr später, 1942, schrieb er »Don Juan, or: The Continuum of the Libido« [Don Juan, oder: Die Einheit der Libido].
Dieses ungewöhnliche, in keine literarische Gattung einzuordnende Buch wiesen alle Verleger auf Grund der offenen Behandlung der Sexualität zurück; es erschien vollständig erst nach Goodmans Tod. Indem er dieses »Museum der Libido« (so seine eigene Charakterisierung des Buches) schrieb, lehnte er die Anpassung an seinen Ruf als ein »Avantgarde-Phänomen« und den Kompromiss mit der Kulturindustrie radikal ab. Offenheit der Sprache empfand er als Voraussetzung für gute Literatur. Er gebrauchte sexuelle Themen jedoch nie als »unterhaltsame Provokation«, sondern im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit den »Fakten des Lebens«, die den Leser mit einbezog.
Aus den Elementen Literatur, akademische Bildung und Erfahrung als Deklassierter entwickelte sich bei Goodman ein Denken und ein Stil von bemerkenswerter Intensität. Schon die Kurzgeschichte »A Cerimonial« [Eine Zeremonie] (1940) und der Roman »The Grand Piano« [Der große Flügel] (1941) zeigten das Wesen von seiner Kritik: gegen die Institutionen und gegen die Unbekümmertheit der Menschen, die sich von Institutionen ein »übliches« Leben aufzwingen lassen.
»A Cerimonial« beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Werbesprache, ausgehend von einer gegen die Werbung gerichteten direkten Aktion. In »The Grand Piano« steht ein New Yorker Junge im Mittelpunkt des Geschehens, der sich um die Schulpflicht herumdrückt. Zentrale Aussage: »Die Stadt als Schule. Zurück zu Sokrates.«
Gegen Ende des Jahres 1944 sollte Goodman zum Kriegsdienst eingezogen werden. Seine strikte Weigerung brachte ihn in die Gefahr, ins Gefängnis zu kommen. (Er wurde dann aber doch ausgemustert.)
Die Frage, ob ein Revolutionär den Kriegsdienst in jedem Falle verweigern sollte, oder das »kleinere Übel« zu wählen habe, war unter den progressiven Literaten und radikalen Linken heftig umstritten. Bereits während des Krieges sah Goodman den deutschen Faschismus nicht als »Natur«-Katastrophe an, sondern als Folge auch der Vorkriegspolitik der Vereinigten Staaten. Der Mehrheit des amerikanischen Volkes war bis zum Kriegsausbruch dies zumindest vage bekannt. Die »Isolationisten« vermochten jedoch keine wirklichkeitsmächtige Politik zu entwickeln. Dieser Zusammenhang wurde im Krieg auch und gerade von den Linken vergessen, verdrängt und seine Benennung ausgegrenzt.
Gegen die Logik vom »kleineren Übel« lautete Goodmans Argumentation: Wenn es in einer konkreten Situation nur die Wahl zwischen einem »größeren« und einem »kleineren« Übel gäbe, hätten wir, die Bürger, politisch etwas falsch gemacht. Anstatt uns der Wahl zu unterwerfen, müssten wir den Fehler ausfindig machen und mit aller Kraft beseitigen. Auf den Weltkrieg bezogen hieß das für Goodman: Anstatt zwischen faschistischem Terror, demokratischem Imperialismus und totalitärem Stalinismus zu wählen und dabei – was immer man wählte – selbst zum Militaristen zu werden, forderte er nun erst recht zum konsequenten Pazifismus auf.
Diese Überlegung fand Verständnis bei den Anarchisten. Die literarischen Avantgarde-Blätter und die marxistischen Zeitschriften, die bis dahin einige seiner Arbeiten veröffentlicht hatten, strichen Goodman allerdings nun aus dem Programm.
Goodmans Selbst-Vergewisserungen über die Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung, gegen die Idee der Koalition mit dem kleineren Übel und über die Umstände, unter denen man Gefängnisstrafen in Kauf nehmen muss, bildeten sein erstes weder literarisches noch literaturkritisches Werk, »The May Pamphlet« [Das Manifest vom Mai] (1945). In diese Zeit fallen auch eine Reihe von psychologisch-politischen Essays, in denen Goodman eine »linke« Freud-Deutung über Wilhelm Reich hinaus versuchte.
Nach dem Krieg betätigte sich Goodman weiter literarisch; aber er veröffentlichte daneben immer mehr politische, soziologische und psychologische Arbeiten. Persönlich befand er sich dabei in einer Sackgasse: Seine politischen Ansichten und sein bisexueller Lebensstil machten ihn zu einem Aussätzigen.
Die Wende in seinem Leben begann, als er 1947 Laura und Fritz Perls traf. Die beiden hatten Goodmans psychologisch-politische Essays im südafrikanischen Exil gelesen und beschlossen, ihn an ihrem Projekt der Gründung einer neuen psychotherapeutischen Richtung zu beteiligen. Goodman arbeitete an dem Buch »Gestalt Therapy« mit, war Mitbegründer des »Institute for Gestalt Therapy« in New York und arbeitete einige Jahre als Gestalttherapeut mit Einzelnen und Gruppen. Zum ersten Mal verdiente er ein wenig mehr, als unbedingt zum Leben notwendig ist.
Gleichwohl nannte Goodman seine Tagebuchnotizen aus den Jahren 1955 bis 1960 »Five Years: thoughts during a useless time« [Fünf Jahre: Gedanken während einer nutzlosen Zeit]. Anerkennung blieb ihm versagt, seine literarische Kraft verebbte, politische Veränderungen erschienen als Utopie. Der Titel jedoch ist falsch. Goodmans Veröffentlichungen, seine Vorträge in kleinstem Kreise, seine Diskussionen, seine Unbeugsamkeit und sein schöpferisches Engagement – alles das war Teil der Vorbereitung auf das Aufbegehren der Jugend und vieler Bürger in den 1960er Jahren.
Seit 1957 hatte Goodman ein Manuskript mit dem Titel »Growing Up Absurd: The Problems of Youth in the Organized Society« [Absurdes Aufwachsen: Probleme der Jugend in der organisierten Gesellschaft] in der Schublade. Eine rasante soziologische Analyse der Schwierigkeiten, in einer perfekt sozialtechnisch organisierten Gesellschaft aufzuwachsen. Als das Buch 1960 endlich einen Verleger gefunden hatte, wurde es – unerwartet – zu einem Bestseller. Die rebellischen Jugendlichen merkten, dass hier nicht einer »über« sie schrieb, sondern in ihrem Namen. Und die anderen merkten, dass sie, wollten sie die Rebellion verstehen, hier und nur hier Aufschluss erhalten konnten.
Das »May Pamphlet« wurde 1962 unter dem Titel »Drawing the Line« [Grenzziehung] zusammen mit Aufsätzen zum Niedergang der Demokratie in der Zeit von Kennedys »demokratischem Faschismus« wieder aufgelegt. Es zeigte sich, dass es den Nagel auf den Kopf traf: Das war das Manifest der Jugendrebellion, nämlich die Aufforderung zur Verweigerung der sozialen Selbstvereinnahmungen, die die gesellschaftlichen Unterdrückungen hatte unsichtbar werden lassen; besonders zur Verweigerung der Zusammenarbeit mit allem, was mit Krieg zusammenhängt, sowie die Forderung nach Aufbau einer anderen, besseren Gesellschaft hier und jetzt.
Zehn Jahre lang war Goodman nun eine »Berühmtheit«, gefragt sowohl bei den Rebellen als auch beim Establishment. Er veröffentlichte Texte zu soziologischen, politischen und psychologischen Themen, hielt Vorträge, trat in Rundfunk und Fernsehen auf, demonstrierte quer durch die USA; er regte Bewegungen gegen das etablierte Schulsystem sowie zur Gründung staats-unabhängiger Alternativschulen an.
Seiner literarischen Neigung versagte Paul Goodman sich fast vollständig. Eine Ausnahme bildet ein Zyklus von Gedichten mit dem Titel »North Percy« (1968), den er in der Trauer um seinen tödlich verunglückten Sohn gedichtet hat. Der Zyklus gilt als eine der bewegendsten Elegien der neueren nordamerikanischen Literatur.
Ende der 1960er Jahre enttäuschte Goodman die Wendung der
rebellischen Jugendlichen zum Leninismus. Eine zusammenfassende
Analyse der amerikanischen Gesellschaft und der Jugendrebellion
lieferte er in »New Reformation: Notes of a Neolithic
Conservative« [Neue Reformation: Notizen eines
Steinzeitkonservativen] (1970). Sein letztes Werk ist »Speaking
and Language: Defence of Poetry« [Sprechen und Sprache:
Verteidigung der Dichtkunst] (1971), in welchem er sich mit
sprachwissenschaftlichen Theorien und deren politischen Dimensionen
auseinandersetzte. Goodman bereitete selbst noch die Ausgabe seiner
»Collected Poems« [Gesammelte Gedichte] vor und verfasste
den philosophischen Essay »Finite Experience«
[Abgeschlossene Erfahrung] als Begleittext zu der Sammlung seiner
»Little Prayers« [Kleine Gedichte], starb aber vor dem
Erscheinen am 2. August 1972 in New
York.
Hauptwerke: The
Bedeutung für die Gestalttherapie: Das sagte Paul Goodman in einem Interview kurz vor seinem Tod 1971 selbst:
»Glasgow: Ich bin sicher, dass eine Menge Leute, die deine neueren Arbeiten gelesen oder dich gehört haben, überrascht wären, wenn sie wüssten, dass du zusammen mit Fritz Perls ein umfangreiches Buch über Gestaltpsychologie geschrieben hast.
Paul: Zusammen?
Glasgow: Oder allein.
Paul: Nun, ich habe den größten Teil geschrieben. Fritz ist ein toller Kerl, aber keiner, der Bücher schreiben kann.
Glasgow: Wie tief bist du in die Gestalttherapie eingedrungen?
Paul: Ich habe zwölf Jahre als Therapeut gearbeitet, und zwar zwölf Stunden am Tag mit nur vier Patienten. Vor und nach den verabredeten Sitzungen lag jeweils eine freie Stunde, sodass die Patienten keine Gelegenheit hatten, zwei Minuten vor Ende der Sitzung die eigentlich wichtigen Themen zu benennen und dann nach Hause zu gehen.
Glasgow: Warum hast du aufgehört?
Paul: Wenn man Therapie wirklich ernst nimmt, bedeutet das eine enorme geistige Belastung. Man verausgabt sich permanent, konzentriert sich und ist aufmerksam. Und ich war einfach nicht glücklich genug, um soviel Energie aufbringen zu können. Gleichzeitig liegt darin eine enorme Befriedigung in dem Sinne, dass man seine Einsamkeit überwindet, weil man weiß, dass man mit wirklichen Menschen in Kontakt ist. Das ist eine wunderbare Erfahrung – wie das Versorgen eines Kindes. Du gibst dich selbst und erwartest keine Gegenleistung; aber irgendwie musst du natürlich auch deine Batterien wieder aufladen. Es war einfach zu hart für mich.[…]
Der Theorieteil von ›Gestalt Therapy‹, den ich komplett geschrieben habe, beinhaltet die Auffassung, dass ein Mensch an der Neurose festhalten muss, weil er in der Gegenwart bestimmte Schwierigkeiten hat. Das heißt, dass die Neurose die wahrscheinlich beste Art und Weise darstellt, mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen.
Solange man nicht die gegebenen Umstände verändert, kann der Neurotiker sein absurdes Verhalten nicht aufgeben. Also befasst man sich systematisch mit den Verhältnissen und sucht nach einfachen Lösungen, die der Patient übersehen hat. Das ist viel interessanter, als den Patienten verändern zu wollen – weil die Neurotiker alle gleich sind. Es gibt ein halbes Dutzend verschiedener neurotischer Verhaltensweisen. Gesundheit hingegen ist einzigartig und vielfältig.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der wichtigste Moment in der Therapie dann gekommen ist, wenn der Patient von seinem eigenen eingespielten Verhalten so gelangweilt ist, dass er einfach damit aufhört. Dieses Gelangweiltsein kann man sich allerdings nur leisten, wenn man Alternativen kennt« (in: Anke und Erhard Doubrawa [Hg.], Erzählte Gestalttherapie, S. 73f).
Laura Perls: »Paul [Goodman] war ursprünglich als Lektor angeheuert worden, aber dann wurden seine Beiträge so gewichtig, besonders zum zweiten Teil, dass Paul zum Mitautor wurde. Ohne ihn gäbe es keine kohärente Theorie der Gestalttherapie« (in: ebd, S. 36).
Erving Polster: »Mit Paul kam ich zusammen, nachdem ich bereits bei Isadore [From] in Einzeltherapie war.
Paul war auf einfache und beglückende Weise verrückt. Er war eine Mischung aus Beglückendem und Verrücktem – für ihn war das ganz einfach. Er inspirierte mich. Er war unglaublich neugierig. Diese Neugier, das Interesse an dem Menschen, mit dem er arbeitete, war sehr viel stärker als sein Interesse an so etwas wie Heilung. Von dieser Neugier habe ich einiges mitgenommen. Und er war immer für einen guten Scherz zu haben. All diese Leute waren auf ihre Art humorvoll, aber Paul hatte eine besondere Beziehung zu Humor. Ich meine, Fritz erzählte Witze, aber Paul kostete sie aus. Er liebte die Köstlichkeit der Beziehung zwischen einer Erfahrung und einer anderen. Und er war gleichermaßen be- und entgeistert. Er lachte über einen Scherz, aber gleichzeitig spürte er auch die Bedingtheit der menschlichen Existenz darin. Er sah einen Scherz nicht bloß als Witz, sondern immer auch als Gedicht. Paul konnte nie verstehen, wie irgend jemand weniger tun konnte, als er.
Wysong: Arbeitete Goodman auch mit dem Buch [gemeint ist Perls, Hefferline, Goodman, Gestalttherapie, 1951] – wie Isadore?
Erving: Nein. Er war mehr ein Straßenphilosoph als ein Gestalttheoretiker. Mir fiel auf, dass die Leute in Cleveland von Pauls Workshops nie so angetan waren wie ich. Wenn Paul einen Workshop machte, kamen nie so viele Leute wie bei den anderen. Das änderte sich auch nicht, nachdem er »Growing Up Absurd« geschrieben hatte. Ein paar von uns waren ganz wild darauf, mit ihm zu arbeiten, aber seine Workshops waren nie so feierlich wie manche andere. Ich habe das nie verstanden. Goodman kreierte nicht dieses Spannungssystem wie Fritz oder Paul Weisz das taten. Er war ein Mann des Gesprächs, ein Geschichtenerzähler, der einen nur gelegentlich herausforderte. Er liebte es auch, Geschichten zu hören. Wenn jemand eine Geschichte erzählte und die anderen sich langweilten, war er doch fasziniert. Und er erzählte gerne selber Geschichten. Aber ich glaube, dass man heute in Begriffen von dichteren oder offeneren Abläufen denken muss« (ebd, S. 198f).
Literatur: Blankertz, Stefan, Gestalt begreifen: Ein Arbeitsbuch zur Theorie der Gestalttherapie, Wuppertal 2003; Doubrawa, Anke und Erhard (Hg.), Erzählte Gestalttherapie: Gespräche mit Gestalttherapeuten der ersten Stunde, Wuppertal 2003; Stoehr, Taylor, Here, Now, Next: Paul Goodman and the Origins of Gestalt Therapy, Cleveland 1994; Screckovic, Milan, Geschichte und Entwicklung der Gestalttherapie, in: ders. u.a. Handbuch der Gestalttherapie, Göttingen 2001.


Die obigen drei Stichworte (Fritz Perls, Laura Perls und Paul Goodman) sind zuerst erschienen in:
Lexikon der Gestalttherapie (von Stefan Blankertz und Erhard Doubrawa)
Das »Lexikon der Gestalttherapie« beschreibt in übersichtlicher und leicht zugänglicher Form die gestalttherapeutischen Fachbegriffe (u.a. Aggression, Deflektion, Introjektion, Konfluenz, Kontakt, Projektion, Retroflektion, Selbst).
Es stellt die Ideen und das Leben der Begründer (Fritz Perls, Laura Perls und Paul Goodman) sowie die Weiterentwicklung der Gestalttherapie bis heute dar. Außerdem beleuchtet es die vielfältigen Wurzeln der Gestalttherapie wie Gestaltpsychologie, Psychoanalyse, Phänomenologie, Existentialismus, Holismus, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Martin Buber usw.
Dieses Lexikon ist die erste lexikalisch-systematische Aufarbeitung der Gestalttherapie und ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden, der sich mit den Erkenntnissen dieses Therapieansatzes beschäftigen möchte.
Gestalt-Institut Köln / GIK Bildungswerkstatt, 2005
347 Seiten, Paperback, Format: A5, 19.90 Euro
Wir senden Ihnen dieses Buch gerne auf Rechnung - natürlich versandkostenfrei!
Bestellanschrift: gik-gestalttherapie@gmx.de
Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen und zahlreiche Stichworte aus dem Lexikon online: www.gestalttherapie-lexikon.de

